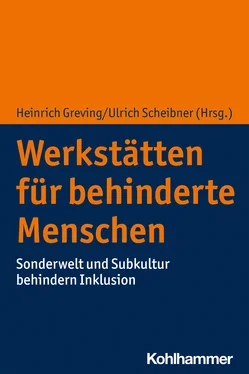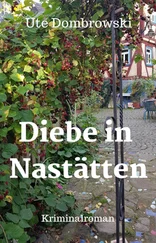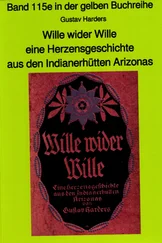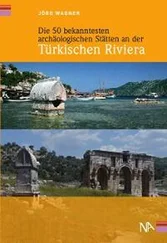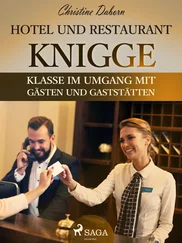2.2 Das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz: zaghaft inklusiv
Besonders seit Ende der 1970er Jahre hatten sich Bundesregierung und Bundestag intensiv mit der Problematik der Benachteiligung eines großen Bevölkerungsteils auseinandergesetzt: mit der Ungleichbehandlung der Frauen. Ihre Zurücksetzung gegenüber Männern im gesellschaftlichen Leben und im Arbeitsleben musste und sollte beendet werden. Denn die 1949 mühsam im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Artikel 3 Absatz 2 GG) entsprach nicht der Lebenswirklichkeit. Auch das sog. Gleichberechtigungsgesetz 9 von 1957 hatte daran wenig ändern können.
Dagegen spielten die Ausgrenzung und fehlenden Teilhabemöglichkeiten der Menschen mit Beeinträchtigungen bis Anfang der 1980er Jahre keine Rolle. In den Bundestagsdokumenten werden sie erst mit Beginn der intensiven öffentlichen Diskussionen über eine Grundgesetzergänzung zur Gleichberechtigung der Frauen erwähnt. 10 Wenn der Bundestag doch einmal den Begriff »Benachteiligung« auf beeinträchtigte Menschen bezog, dann ging es zumeist um finanzielle Nachteile und weniger um ihre gesellschaftliche Diskriminierung. 11 Mit den Protestaktionen der sich selbst so bezeichnenden Krüppelbewegung kam das Thema mehr und mehr ins öffentliche Bewusstsein. Die fand 1981 einen Höhepunkt in zwei Schlägen mit der Gehhilfe ihres Mitbegründers Franz Christoph (1953–1996) auf den damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens (1914–1992; Bundespräsident 1979–1984). Dabei sollte der Bundespräsident nicht verletzt werden. Christoph wollte die Diskriminierung und die Unfähigkeit der Gesellschaft, angemessen mit Menschen mit Beeinträchtigungen umzugehen, sichtbar machen. Übrigens: Als »Krüppel« war er keine Strafanzeige wert. Sie wurde auch nicht erstattet. 1981 war das Jahr, das von den Vereinten Nationen erstmal als »Internationales Jahr der Behinderten« begangen worden war.
Dass tatsächlich politischer Handlungsbedarf in Bezug auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben besteht, diskutierte der Bundestag erstmals, nachdem am 5. Mai 1992 ein europa- und bundesweiter Protesttag behinderter Menschen stattgefunden hatte. Diesem großen Aktionstag ging 1991 der »Düsseldorfer Appell« des Initiativkreises »Gleichstellung Behinderter« voraus. Darin wurde gefordert, allen behinderten Menschen die gleichen Bürger- und Menschenrechte zuzugestehen. Die sollten in einem umfassenden Gleichstellungsgesetz gesichert werden. Der querschnittsgelähmte Parlamentarier Ilja Seifert (PDS) 12 setzte sich für weitreichende gleichstellende Rechtsnormen ein. Er verlangte von der Bundesregierung, politische und grundgesetzliche Konsequenzen aus dem Protesttag zu ziehen.
Die abweisenden Antworten der Bundesregierung empfanden nicht nur Vertreter der engagierten Verbände behinderter Menschen als völlig ungenügend. Diese Ablehnung entsprach aber weitgehend der in der Gesellschaft vorherrschenden Haltung. So fand sich auch in der Verfassungskommission des Bundestages 1993 nicht die notwendige Zweitdrittelmehrheit für eine entsprechende Grundgesetzänderung (BT-Drs. 12/6000, 1993, 53). 13 Das ist umso bemerkenswerter, als 1993 das »Jahrzehnt der behinderten Menschen« endete.
Im Regierungsbericht »über die Lage der Behinderten« von 1994 wurde noch behauptet, »dass es nach Einschätzung der Bundesregierung keine rechtlichen Benachteiligungen Behinderter gibt« (BT-Drs. 12/7148, 1994, 3). Gleichzeitig aber hielt sie die »Weiterentwicklung der rechtlichen und tatsächlichen Situation der Werkstätten für Behinderte« für notwendig. Der Rechtsstatus der Werkstattbeschäftigten war bis dahin völlig ungeklärt und blieb bis 1996 ungeregelt. 14
Wie die soziale Benachteiligung behinderter Menschen beendet werden kann, wurde bis in den Sommer 1994 öffentlich und im Bundestag heftig diskutiert (PlPrt. 12/222, 1994, 19232 D ff.; PlPrt. 12/235, 1994, 20651 C ff.). Noch siebzig Tage vor der Verabschiedung der heute selbstverständlich erscheinenden Verfassungsergänzung wies die Bundesregierung sowohl eine Grundgesetzergänzung zurück als auch ein Gleichstellungsgesetz. Stattdessen hielt sie es für denkbar, ein Benachteiligungsverbot in das geplante Neunte Buch im Sozialgesetzbuch (SGB IX) aufzunehmen. 15 Das wurde allerdings erst 2001 und damit sieben Jahre später verabschiedet.
Ohne persönliche Einflussnahme des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (1930–2017, Kanzler 1982–1998) wäre eine entsprechende Grundgesetzänderung zumindest noch im selben Jahr 1994 nicht möglich gewesen. Einfluss auf ihn hatte dabei wohl auch das Attentat von 1990 auf seinen Parteifreund Wolfgang Schäuble (Jg. 1942, seit 2017 Bundestagspräsident). Der wurde bei einer Wahlveranstaltung niedergeschossen und ist seitdem querschnittsgelähmt. 16
Offensichtlich ist: Ohne den Parlamentsbeschluss über die staatliche Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern hätte es die Antidiskriminierungsregelung im Grundgesetz zum damaligen Zeitpunkt nicht gegeben. Die damit verbundene lange und intensive Diskussion um diesen ausdrücklichen grundgesetzlichen Gleichstellungsauftrag an den Staat hat auch die Haltung gegenüber behinderten Menschen verändert. So wurde am 6. September 1994 mit der Neufassung des Artikels 3 Grundgesetz auch das Benachteiligungsverbot in Absatz 3, Satz 2 beschlossen: 17
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) 1Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 2Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) 1Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 2Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Der Forderung der Selbsthilfeorganisationen behinderter Menschen, den Staat – analog zur Regelung für Frauen – grundgesetzlich auch zu verpflichten, die Benachteiligung behinderter Menschen zu beseitigen, folgte das Parlament nicht.
2.3 Die politische Weichenstellung in Richtung »Sonderarbeitswelt«
Bis in die 1990er Jahre wurde die Ausgrenzung und Isolation jener Menschen kaum thematisiert, die wegen ihrer Beeinträchtigung keinen Zugang zur Erwerbswirtschaft hatten. Wesentliche Verbesserungen waren in der Regel finanzieller Art und auf das Engagement der Sozialverbände zurückzuführen. In denen waren aber überwiegend Kriegsopfer organisiert. Weder die gesellschaftlich einflussreichen kirchlichen Verbände noch die politischen Parteien hatten sich als »Anwälte der Behinderten« in Bezug auf mehr gesellschaftliche Teilhabe besonders ausgezeichnet. 18 Mit dieser Kritik musste 1999 auch die SPD als Regierungspartei unter Bundeskanzler Gerhard Schröder zurechtkommen. Dieser senkte sogar den Druck auf die Arbeitgeber, behinderte Menschen einzustellen: Die sog. »Pflichtquote«,die gesetzlich vorschreibt, einen bestimmten Prozentsatz der Arbeitsplätze mit »schwerbehinderten Menschen« zu besetzen, wurde von 6 auf 5 % reduziert.
Die politischen Entscheidungen waren aber im Grunde bereits Anfang der 1960er Jahre gefallen – eindeutig zugunsten eines Sondersystems »Werkstätten für Behinderte«. Zunächst wurden diese »Werkstätten« – wie zuvor schon das unauffällige System der »Blindenwerkstätten« – von der Umsatzsteuer befreit (BT-Drs. 04/1590, 1963, 45). Dann erhielt die damalige Bundesanstalt für Arbeit durch das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 den gesetzlichen Auftrag, »den Aufbau, die Erweiterung und Ausstattung von Werkstätten« mitzufinanzieren (§ 61 Abs. 1 AFG). Zu einer umfassenden Sonderwelt entwickelte sich dieses »Werkstätten«-System schließlich aufgrund des Aktionsprogramms der Bundesregierung von 1970: »Anzustreben ist ein möglichst geschlossenes System von Einrichtungen, das alle Teilbereiche der Rehabilitation einbezieht: […] Werkstätten für Behinderte, wo diejenigen arbeiten können, für die der freie Arbeitsmarkt nicht oder noch nicht zugänglich ist« (BT-Drs. 06/643, 22).
Читать дальше