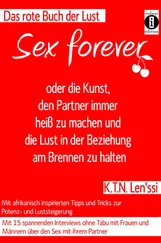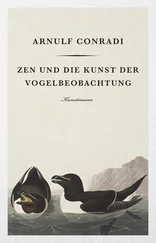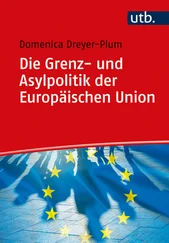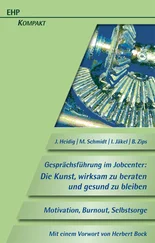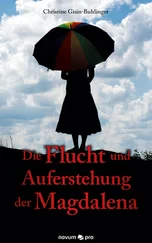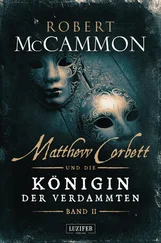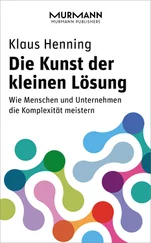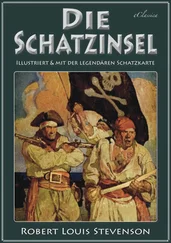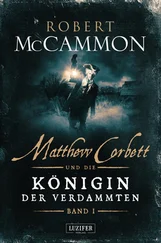Als nächstes und für all jene, die noch wenig damit vertraut sind, lassen sie uns einmal einen Blick darauf werfen, wie neuartige Ideen bezüglich Struktur-Funktions-Wechselwirkungen im osteopathischen Denken in Erscheinung traten und sich dort mit der Zeit manifestierten, gemeinsam mit jenen außergewöhnlichen Aspekten, die mir, wie so vielen anderen auch, sehr am Herzen liegen.
Viele dieser Aspekte mögen für die meisten Studenten zunächst nur von nachrangiger Bedeutung sein, dennoch trifft dies auf einige nicht zu und bei wieder anderen handelt es sich wohl um die aufregendsten und bedeutendsten Aspekte überhaupt. Aber was liegt der praktischen Osteopathie zugrunde, was untermauert sie? In späteren Kapiteln wird einiges hiervon untersucht, im Sinne von: Was bringt alles zum Leben, was macht es lebendig und was macht es so bedeutend für den Menschen und seinen Körper? Zunächst lassen Sie uns aber einmal einen Blick auf die grundlegenden Lehren werfen und über die Art und Weise sprechen, wie diese Ideen über die Jahre erweitert wurden.
Zunächst, worum handelt es sich eigentlich bei diesem Struktur-Funktions-Prinzip?
Nun, es besagt, dass die Gesundheit und die mechanische Integration der Strukturen des Körpers, sein muskuloskelettales und Bindegewebssystem den Gesamtzustand einer Person widerspiegeln und sich selbst ebenfalls in ihr spiegeln, wobei sich dies primär auf der physiologischen Ebene vollzieht. Viele, wenn nicht sogar der größte Teil der Osteopathen, erweitern dieses Einflussgebiet und beziehen die mental-emotionale und spirituelle Ebene des Wesens mit ein. Jedes tatsächlich holistisch ausgerichtete Konzept würde von dieser Art von Unterteilungen Abstand nehmen. Für den Moment lassen wir jetzt erst einmal diese unterschiedlichen Aspekte des Organismus als separate Studiengebiete beiseite, auch wenn diese Trennung aus einleuchtenden Gründen in gewissen Stadien des Studiums vorkommt. (Problematisch ist nur, dass sie in der Allgemeinmedizin häufig getrennt verbleiben , was sich in den stark fachspezifisch orientierten Behandlungsstrategien widerspiegelt. Aber mehr darüber später.)
Orthodoxe Ärzte und Chirurgen unterscheiden sich im Ausmaß der Akzeptanz dieser Vorstellungen. Die einen behaupten, es sei ja offensichtlich, dass geschädigtes Gewebe eindeutig eine veränderte Form darstelle und eine dementsprechend veränderte Funktion aufweisen müsse. Andere wiederum finden die Behauptungen des gesamten Konzepts sonderbar, für sie bleibt die funktionelle Verschmelzung von Struktur und Physiologie schwer zu fassen; es widerstehe jeder Übertragung in eine therapeutische Annäherung.
Werfen wir zwischenzeitlich einen Blick auf Theorien, die das Modell des Struktur-Funktion-Dialogs untermauern und auf das viele Osteopathen (und andere aus verwandten Bereichen) ihr Denken begründen.
Wie beeinflussen Struktur und Funktion sich gegenseitig?
Die Ideen, die hier zur Debatte stehen, haben unterschiedliche Entwicklungsstufen durchgemacht, zum Teil spiegeln sie die Kultur ihrer Zeit wider, zum Teil die Kühnheit ihrer Vertreter. Bemerkenswerterweise scheinen Stills Ideen umso vorausschauender gewesen zu sein, bedenkt man, dass die Theoriefindung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch eine ziemlich übermechanistische Phase geprägt war, aus der wir gerade erst anfangen langsam aufzutauchen. In seinem Textbook of Osteopathy beschrieb Thomas Dummer die Entwicklung der Osteopathie und fasste sie zu den folgenden, ausgedehnten Phasen zusammen:
1874 – 1900/1920: die gestaltende Phase
1920 – 1950/1960: die strukturelle/mechanische Phase
1960 – 1975: vermehrte kraniale/funktionelle Einflüsse
seit 1975: eine zunehmende Rückkehr zu den Quellen , einschließlich der Wiederbekräftigung des Holismus und von Stills Prinzipien mit einer gleichmäßigen Gewichtung von strukturellen und funktionellen Ansätzen.33
Bei den einzelnen Phasen handelt es sich selbstverständlich lediglich um grobe Zeitbezüge. Man kann jedoch sagen, dass die jeweiligen Perioden die Kultur ihrer Zeit widerspiegeln. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war man reif für Neuerungen und unterstützte Stills bahnbrechende und prägende Ideen. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte eine bemerkenswerte Ausbreitung und Verbesserung der Produkte einer mechanistischen Kultur, die in der industriellen Explosion des 19. Jahrhunderts verwurzelt waren. Viele raffinierte, schwer nachvollziehbare Konzepte der osteopathischen Theorie wurden konsequenterweise in überspitzten mechanistischen Begriffen und mittels mechanischer Analogien ausgedrückt. Die noch immer anhaltende Tendenz osteopathische Prozesse sowie die muskuloskelettale Funktion zu übermechanisieren kann durchaus als eine Folge dessen angesehen werden.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte eine starke Entwicklung in Bezug auf Elektronik und der Elektrotechnik durch die Festkörperforschung und begleitet von der Verbreitung jener Maschinen, deren Mechanismen sauber und unsichtbar waren. Es entwickelte sich eine Raffinesse im osteopathischen Denken, die differenziertere neurale und fluidale Dynamiken berücksichtigte und weniger Betonung auf den Körper als Maschine legte, dessen Teile auf mechanischem Wege in eine Ordnung gebracht werden müssten. Zugleich hielt die Quantentheorie Einzug in die Produktion von Ausrüstungen und Alltagsgegenständen unterschiedlichster Art. Dies bedingte die Zunahme von Nanotechnologie und einige Osteopathen sympathisierten mit faszinierenden Rückschlüssen der Quantentheorie, da sie zugleich Aspekte der Physiologie wie auch der Technik beleuchtete. Nun konnte man sowohl im öffentlichen Bereich wie auch bei Studenten und Behandlern ein wachsendes Interesse für subtile Behandlungsmethoden feststellen. Gekoppelt mit Systemtheorie, Ökologie, Chaostheorie und Globalisierung bahnte sich der holistische Anspruch seinen Weg mit größerem Selbstvertrauen denn je. In dieser Zeit begann man Stills (und Sutherlands) Prinzipien erneut aufzugreifen, neu zu interpretieren und die Osteopathie so voranzubringen, und zwar um ihretwillen (und nicht trotz ihrer, wie dies einige gerne gesehen hätten).
Verallgemeinernd kann man sagen, dass die Betonung unterschiedlicher Aspekte des Struktur-Funktions-Dialogs auf folgenden Gründen beruht:
der spezifischen historischen Periode in der Geschichte des Berufsstands;
der jeweils besuchten Schule und ihrem Einfluss;
dem Ansatz oder der Orientierung, zu der man sich grundsätzlich hingezogen fühlt, was zum größten Teil auf eigene Ideen, Philosophien, Auffassungsgabe etc. zurückgeht.
Grundregeln und Struktur-Funktion-Verbindungen
Gehen wir nun einmal die grundlegenden Lehren der osteopathischen Methoden durch, also jene Konzepte, denen der größte Teil des Berufstandes zustimmt (wenn auch nicht alle!). Kurz gesagt ruhen all diese Konzepte auf drei fundamentalen Säulen:
Dynamik der Flüssigkeiten,
Informationsübertragung und Regulation,
konstitutionelle Vitalität.
Mit anderen Worten, wir haben es mit Flüssigkeiten, Nerven und Feldern zu tun. Alle drei, gut integriert, ermöglichen es dem Körper seinem Potential an Selbstregulation, Gesundheit und Heilung Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus ist die effektive Wirkung des Gewebes, aus dem die Körperstruktur besteht (genauso wie alles andere Gewebe), aufs engste mit der Funktion dieser drei grundlegenden Aspekte verflochten. Dies nicht unbedingt in Form von Ursache und Wirkung, sondern vielmehr als Teil des Ganzen. (Sobald wir es mit lebendigem Gewebe zu tun haben, wäre es daher wohl besser in Begriffen von Struktur als Funktion zu denken, da sie in diesem Sinne praktisch untrennbar verbunden sind. Trotzdem tendieren wir immer noch dahin sie zu differenzieren, da Struktur anscheinend eher manuell zugänglich und somit das Konzept leichter zu unterrichten ist.)
Читать дальше