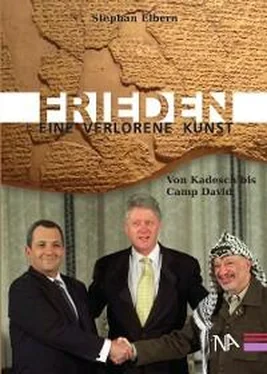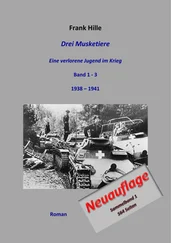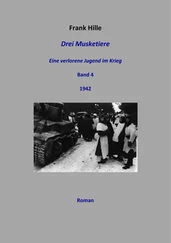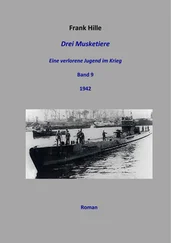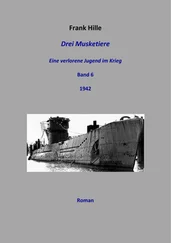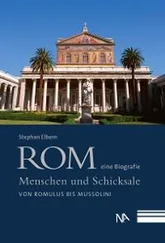Zunächst besiegelte der Ausgang des Peloponnesischen Krieges die Hegemonie der Spartaner über Griechenland. In den folgenden Jahren zeigte sich jedoch, dass weder ihre politische Führung noch ihr bedeutendster Feldherr Lysander ein zukunftsweisendes Konzept besaßen. Überall in Hellas wurden oligarchische Regierungen installiert, gesichert durch spartanische Besatzungen. Aber schon bald waren die neuen Machthaber weitaus unbeliebter als die einstigen athenischen Herren; in einem Klima rigider Moral aufgewachsen, hielten sie sich im „Ausland“ für ihr früheres entbehrungsreiches Dasein schadlos und zogen sich durch Arroganz und schamlose Bereicherung den allgemeinen Hass zu; außerdem zeigten sie eine geradezu erschreckende politische Unfähigkeit. In Athen währte die blutige Herrschaft der „Dreißig Tyrannen“ – denen auch Theramenes zum Opfer fiel – nur ein Jahr. Zudem verlor Sparta die persische Unterstützung; nun floss das Gold des Großkönigs an den einstigen Kriegsgegner und ermöglichte einen Wiederaufstieg Athens, das dennoch nie mehr seine frühere Macht erlangen sollte.
Der eigentliche Nutznießer der zunehmenden griechischen Zersplitterung war hingegen das Achämenidenreich, das schon bald im Königsfrieden seine außenpolitischen Ziele durchsetzen konnte.
Griechische Zersplitterung: Der Königsfrieden (387/86 v. Chr.)
Die verhängnisvolle Uneinigkeit der kleinen Stadtstaaten ermöglicht dem persischen Großkönig, den Griechen seinen Willen aufzuzwingen; Hellas versinkt im Chaos.
In einem langjährigen erbitterten Ringen hatte Sparta im Peloponnesischen Krieg (431 – 404 v. Chr.) die Vorherrschaft über Hellas erkämpft. Nun forderte der persische Großkönig Artaxerxes II. den damals vereinbarten Preis für die achämenidische Unterstützung: die Auslieferung der kleinasiatischen Griechenstädte. Jetzt aber warfen sich die Spartaner zu deren Schutzmacht auf und begannen unter ihrem König Agesilaos einen Feldzug gegen das Achämenidenreich. Daher förderte der Großkönig ihre innergriechischen Gegner; mit persischem Gold wurden Theben, Korinth und Argos gewonnen, der Athener Konon baute eine neue Flotte auf. Der Ausbruch des Korinthischen Krieges (394 – 387 v. Chr.) zwang Agesilaos zur Rückkehr nach Griechenland. In den Schlachten von Nemea und Koroneia bewährte sich nochmals die Überlegenheit der spartanischen Hopliten, die Entscheidung fiel jedoch zur See: Bei Knidos vernichtete Konon die spartanische Flotte. Im Triumph zog der siegreiche Admiral in die Vaterstadt ein und erneuerte die Langen Mauern; auch die zur Versorgung Athens lebenswichtigen Inseln Lemnos, Imbros und Skyros wurden zurück gewonnen.
Gleichzeitig verhandelten die Kriegsgegner in Sardes mit dem persischen Satrapen Tiribazos; nun gewann der spartanische Gesandte Antialkidas4 die finanzielle Unterstützung des Großkönigs für seine Heimatstadt – allerdings gegen die erneute Preisgabe der kleinasiatischen Griechenstädte (393/92 v. Chr.). In den folgenden Jahren zog sich der Krieg bis zur allseitigen (v. a. wirtschaftlichen) Erschöpfung hin. Inzwischen zum Nauarchen aufgestiegen, begab sich Antialkidas gemeinsam mit Tiribazos an den königlichen Hof nach Susa; dort wurde ein allgemeiner Friede für Hellas vereinbart. Nachdem die Drohung mit einer Hungerblockade durch eine persisch-spartanische Flotte den Widerstand Athens gebrochen hatte, stand dem Abkommen nichts mehr im Wege.
In Sardes wurde der „Königsfrieden“ (auch Antialkidas-Frieden genannt) den Gesandten der griechischen Staaten mitgeteilt und im folgenden Jahr zu Sparta beschworen (387/86 v. Chr.). Er sprach die hellenischen Städte Kleinasiens sowie Zypern dem Großkönig zu; alle Poleis in Griechenland sollten autonom sein (mit Ausnahme der für Athen lebensnotwendigen Inseln); den Widersachern dieses Vertrages drohte der persische Herrscher mit Krieg zu Wasser und zu Lande. Bereits für die Zeitgenossen war damit der Tiefpunkt der griechischen Geschichte erreicht; alle früheren Erfolge über die „Barbaren“ – die Siege von Marathon und Salamis, bei Plataiai und am Eurymedon – waren verspielt, die einst ruhmreich befreiten hellenischen Städte dem Feind preisgegeben.
Königliches Diktat – kleinasiatische Griechenstädte verloren
Die „allgemeine Autonomie“ sicherte zunächst die Vorherrschaft Spartas, denn sie erlaubte dem Kriegerstaat, gegen jede Machtkonzentration in Griechenland vorzugehen, etwa den Boeotischen Bund der Thebaner; so wurde die Burg von Theben – mitten im Frieden – rechtswidrig besetzt. Ein erfolgreicher Handstreich zwang jedoch die spartanische Garnison zur Übergabe; Athen trat auf die Seite der einstigen Gegner und erneuerte seinen früheren Seebund. Ein allgemeingriechischer Kongress in Sparta sollte den Königsfrieden erneuern; dies scheiterte jedoch an der Forderung Thebens nach einer Anerkennung seines Bundes. Wenige Wochen später mündete der Straffeldzug der Spartaner in der vernichtenden Niederlage bei Leuktra; davon hat sich der Kriegerstaat nie mehr erholt (371 v. Chr.).
Es folgte eine kurzlebige Hegemonie Thebens, die freilich schon bald mit dem Heldentod seines genialen Feldherrn Epameinondas endete.5 Danach versank Griechenland vollends im Chaos. Die Zeit war reif für eine Einigung des zersplitterten Landes; Philipp II. von Makedonien sollte dieses Werk vollbringen.
Die Einigung Griechenlands: Der Friedenskongress von Korinth (338/37 v. Chr.)
Nach dem entscheidenden Sieg bei Chaironeia vereint Philipp II. die griechischen Stadtstaaten im Korinthischen Bund; damit ermöglicht er den Siegeszug seines Sohnes Alexander d. Gr. durch Asien.
Jahrhundertelang hatten sich die hellenischen Poleis in blutigen Bruderkriegen zerfleischt; unentwegt rangen sie um die Vorherrschaft in Griechenland. Im Peloponnesischen Krieg hatte Sparta die Vormacht Athens gebrochen, danach jedoch durch schwere Fehler die eigene Hegemonie verspielt. Mit dem glänzenden Sieg bei Leuktra (371 v. Chr.) war Theben an die Stelle des Kriegerstaates getreten; seine Macht beruhte jedoch lediglich auf dem militärischen Genie des Epameinondas. Nach dem Tod des Feldherrn herrschte in Hellas politisches Chaos. Nutznießer der griechischen Zersplitterung war das Reich der Achämeniden; im Königsfrieden hatte es die hellenischen Städte Kleinasiens zurück gewonnen; persisches Gold beeinflusste maßgeblich die innergriechischen Auseinandersetzungen.
Da wuchs ein neuer Machtfaktor in Hellas heran – das aufstrebende Reich der Makedonen unter seinem politisch, wie militärisch hoch befähigten König Philipp II. (359 – 336 v. Chr., geb. um 382). Tatkräftig festigte er die Stellung des Herrscherhauses; durch siegreiche Feldzüge mehrte er das makedonische Territorium und baute eine schlagkräftige moderne Armee auf; seine Macht bedrohte schon bald das Gleichgewicht der Kräfte in Griechenland.
Beim weiteren Vordringen nach Süden stieß der König auf die Interessensphäre Athens. Dort erkannte der hochberühmte Redner und Staatsmann Demosthenes die drohende Gefahr; in den Philippischen Reden propagierte er gegen die wachsende Macht des makedonischen Herrschers die griechische „Freiheit“ (die vor allem die Möglichkeit bedeutete, sich weiterhin gegenseitig zu bekämpfen). Zweifellos tapfer und unbestechlich, zudem bereit, bis zum bitteren Ende für die eigene Überzeugung ein zustehen, vertrat er ein längst überholtes Ideal, auf dem die damalige Schwäche des Griechentums beruhte. Dagegen erkannte sein Rivale Isokrates die historische Chance: Philipp sollte das zersplitterte Hellas einen und zum Rachekrieg gegen das Achämenidenreich führen.
Ein Friedensabkommen mit Athen (346 v. Chr.), das freilich eher einem Waffenstillstand glich und die entscheidende Auseinandersetzung lediglich aufschob, nutzte der kluge Herrscher, um seinen Einfluss in Mittelgriechenland und auf der Peloponnes zu mehren.
Читать дальше