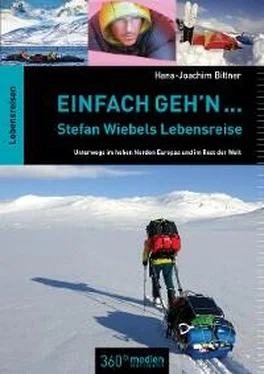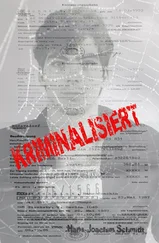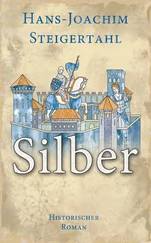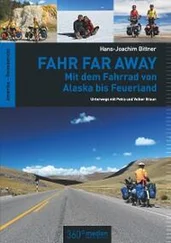Sein Inneres schrie nach Wasser
Schemenhaft erkannte er das Umfeld. Das Wissen um das Passierte kroch langsam in ihm hoch. Wie der Schmerz. In höllischem Ausmaß. Er erreichte sein Gehirn. Das funktionierte bestens. Ein Glück. Er spürte noch. Spürte noch Schmerz, Unbehagen, Ungewissheit. Stefan hob quälend den Kopf. Und er prüfte: Alles war noch dran, aber war da noch mehr als das brutale Schlagen dort unten, rechts, zwischen Schienbein und Fuß? So blau, so angeschwollen. Nein, nur noch ein paar Schrammen, Prellungen, Kopfschmerzen, unsägliche Kopfschmerzen hinter der Stirn, den Augenhöhlen, unter der zentralen Schädeldecke, Nordhirn. Es gab kein Wasser, nirgends ein Bach, ein kleiner See, nicht mal mehr ein wenig Schnee. Jetzt rächte sich sein Lapsus vom Aufstieg. Sein Inneres schrie nach Flüssigkeit.
Der Schock verging, der Plan reifte: Runter vom Berg, runter von den rund 4.500 Metern, der Höhenluft, so schnell wie möglich. Er schlief ein, sein Körper forderte jetzt diese Ruhe. So wie Wasser. Das alles war doch zu heftig gewesen, der Aufprall zu intensiv. Ein paar Schmerzmittel hatte er dabei, ein First-Aid-Paket. Es half über das schlimmste Pochen hinweg. Nur kurz. Er nahm mehr, zu viel, viel zu viel, statt „25 bis 30 Valeron-Tropfen empfohlen“ fast die doppelte Menge. „Die beamte mich komplett weg“. Die Höhe leistete ihr Übriges.
Nachtkälte riss ihn hoch. Sie kam schleichend. 1.000 Höhenmeter musste er abwärts überwinden, mindestens, schleppend, keuchend, schmerzhaft, anders ging es nicht. Stefan erreichte geschwächt Sandboden, immerhin, ein paar Holzhütten. Dort haben sie ihn angeschaut, als käme er direkt vom Mond. Arme Bauern, die hier oben ein wenig Ackerbau und Viehzucht betreiben. Sie ließen ihn schlafen, bei sich, im Warmen. Essen gab es kaum. Sie hatten selbst so wenig. Ein wenig Trinken, wenigstens. Verstanden haben sie sich nicht. Und sein Tun schon gar nicht.
Stefan trennte sich. Jedes Gramm war ihm jetzt zu viel. Er ließ seinen Schirm in einem hohlen Baumstumpf voller Harz verschwinden. In der Hoffnung, ihn irgendwann dort wieder abholen zu können. Das Loch schloss er mit umherliegenden Ästen. Ein paar wichtige Accessoires behielt er: Die Steigeisen, den Schlafsack, die Isomatte, den Esbitkocher, die Teleskopstecken, die er als Ersatzkrücken einsetzte, für den verletzten Fuß.
Steigeisen-Zaun
Wieder musste er schlafen, in der Ferne hörte er die Wildhunde heulen. Wieder war es kein Schlaf, nur ein Dämmern, kurz, keine Erholungschance. Unbarmherzige Minusgrade rüttelten ihn einmal mehr wach, und das monotone Heulen. Beides rettete ihm das Leben. Lange vor jeglichen Handy-Zeiten musste er sich jetzt endlich und entscheidend selbst helfen, die Schmerzmittel richtig einsetzen, Schritt für Schritt absteigen, langsam, aber doch stetig und gleichmäßig Höhe verlieren. Noch eine Eisnacht unter freiem Sternenhimmel, zum Glück kein Regen. Die Steigeisen stellte er rings um sich herum als schützenden „Zaun“ auf, gegen den möglichen Angriff der Heuler, der Kojoten. So dachte er, er wusste es nicht. So viele Gedanken, so viele Ängste, so lange zum praktischen Handeln verurteilt. Als der Bayer nach drei Tagen wieder ins Dorf seines Aufbruchs humpelte, endlich den Vulkan hinter sich gelassen hatte, empfing ihn die mexikanische Familie, die ihn zuvor bewirtet hatte, im Tal erleichtert, ja überschwänglich.
Jetzt war Stefan gefesselt. An ein schmales mexikanisches Bett. Zum Arzt wollte er nicht, es würde alles wieder von selbst heilen, war er sich sicher. So oder so: Er musste sich schonen. „Ich hatte keine Wahl.“ Seine Sachen hatte er noch in einer kleinen Pension, doch seine neue Gastfamilie holte ihn zu sich, sie hatte genug Platz. Und einen Stock zum Aufstützen, zum Entlasten des kaputten Fußes. Ihrem Drängen konnte er irgendwann nicht mehr standhalten. Das Mountainbike kam an einen trockenen Platz im Hof, sicher verwahrt. Stefan bezog sein neues Zimmer.
Er bewies Geduld, schonte sein lädiertes Sprunggelenk, legte es hoch und ließ es dort. Der Plan, Mexiko zu durchradeln, war vorerst auf Eis gelegt. Der Abgestürzte und Durchgekommene wartete auf Besserung. Die Familie „Medico“ besorgte Salben, „mit etwas Kühlem drin“. Weihnachten kam, Silvester und Neujahr gingen. 9.500 Kilometer von daheim, dort wussten sie lange nichts von seinem Tun, seinem Unfall, seiner neuen Bleibe, seinen Plänen. Damals gab es noch keinen Mailverkehr, keine Handys. „Ich hab mal eine Postkarte geschrieben, aber die war wochenlang unterwegs.“ Mit den Eltern hatte er in all den Monaten in Lateinamerika – am Ende sollten es acht sein – höchstens dreimal telefoniert.
Mexiko begrüßte das Jahr 1992 mit einer großen bunten Feier. Auch das Dorf, in dem Stefan stark lädiert gelandet war. Alle waren auf der Straße, alle jubelten, sangen, tanzten. Es sprach sich rum, dass da ein Gringo, noch so jung und unerfahren, seine Wunden leckte. Alle wollten mit dem Verrückten, der immer besser Spanisch lernte, anstoßen. Trinken mit dem Deutschen, der vom Citlaltépetl gesprungen und von ihm gefallen war. Ohne Rettungsschirm. Weit abseits vom Gringo-Trail, zeigte Mexiko seine ganz andere Seite: „Da ging’s rund, unbeschreiblich.“
Es wurde ihm zu heiß
An jeder Ecke dampfte es und roch nach vielerlei. Fremde Gerüche für eine europäische Nase. Er machte seine Runde um den Zócalo, spazierte um den kreisrund angelegten Stadtpark, das Zentrum einer jeden mexikanischen Stadt. Hier, wo die großen und kleinen Metropolen des mittelamerikanischen Staates pulsieren und tausende Dämpfe wabern. Stefan trieb sich am Markt herum, sah sich viel an, war beeindruckt von den tollen Geschäften, die alles und nichts hatten. Und Stefan verliebte sich. Ganz langsam. Ihm selbst war das zunächst noch gar nicht bewusst. Nadia ( Name geändert ) war es, eine der drei Töchter der Familie, die sich um ihn kümmerte. „Alle drei waren hübsch, sehr hübsch, aber die eine …“. Sie war vergeben, eigentlich. An einen Polizisten, der immer am Wochenende kam. Und sie war schwanger, vom Ordnungshüter, zweifelsfrei. Der Bruder wachte über das Schwestern-Trio, die Mutter durfte von alledem noch nichts wissen. Stefan war das alles zu heiß, er musste weiter. Vorerst.
Der ursprüngliche Traum war dahin: Radeln ja, vielleicht, fliegen nein, ganz sicher. Er hatte ohnehin keinen Schirm mehr, der war oben, in einem Föhren-Baumstumpf. Gut versteckt, am Pico de Orizaba. Stefan suchte ihn vergeblich, als er später auf seinen Unglücksvulkan zurückkehrte. „Vermutlich haben sie mich dabei beobachtet, die Bauern, wie ich ihn in dieser Stammhöhle versteckte. Ich stand davor, da war ich mir sicher. Es war der richtige Baum.“ Sie konnten ihn gebrauchen, zu was auch immer. Zum Fliegen keinesfalls. Das Material war neu für sie, es hat sie garantiert fasziniert. Das Fluggerät war verschwunden.
Der Vulkan, der ihn einfach liegenließ, brachte Stefan schon wieder kein Glück. Nicht einmal danach.

Kapitel IV: Schon wieder ein Leben kaputt

Unterwegs in Lateinamerika.
Kapitel IV: Schon wieder ein Leben kaputt

Er wollte Spanisch lernen. So richtig, mit allem drum und dran. Jetzt, auf der Stelle. In Guatemala, einem landschaftlich einzigartigen Land, das nach vielen Bürgerkriegen in Korruption und Armut versank. Die Sprachschule war in Quetzaltenango, auf 2.234 Meereshöhenmetern. Für einen Monat schrieb sich Stefan ein. Er wohnte drei Wochen bei einer Familie, und er lernte Spanisch, in einer Stadt, die für ihre Sprachschulen bekannt ist und eine Partnerschaft mit dem norwegischen Tromsø pflegt, der nördlichsten Universitätsstadt der Welt. Jener Metropole im so weit entfernt liegenden Europa, etwas nördlich des Polarkreises, zu der Stefan sehr viel später ebenfalls eine Verbindung aufbauen sollte. Heute spricht er fließend Castellano. Es hat sich gelohnt, die Mühe in Lateinamerika. Manchmal fallen ihm die deutschen Begriffe für spanische nicht ein, wenn er erzählt.
Читать дальше