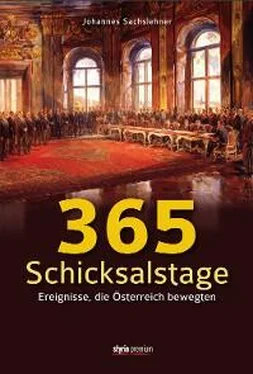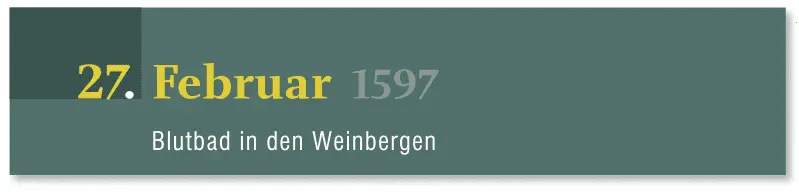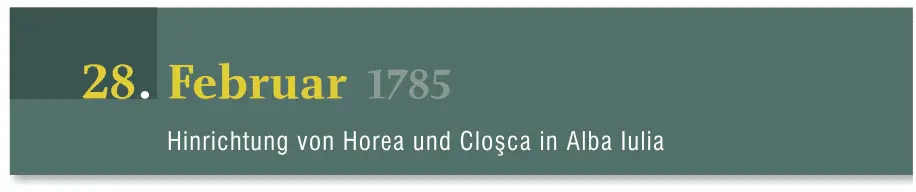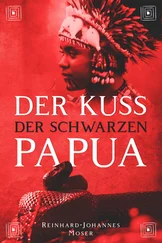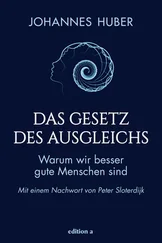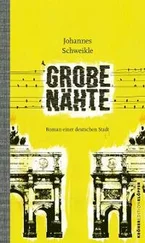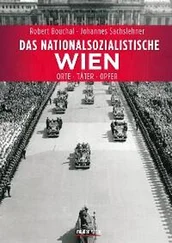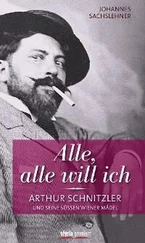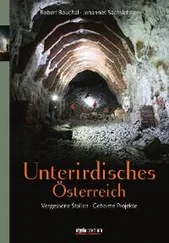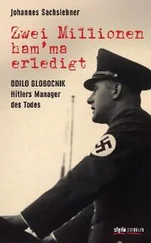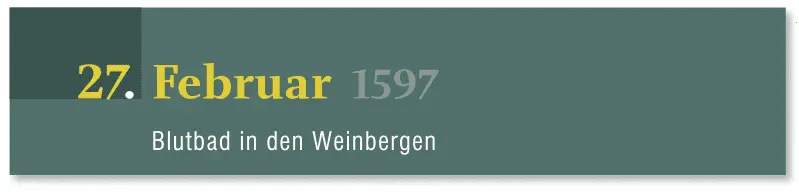
Bauernaufstand in Niederösterreich
Anno Domini 1597 entfällt in Niederösterreich der Fasching. Im Most- und Waldviertel haben sich die Bauern gegen die Grundherren erhoben; Landesherr Erzherzog Matthias verbietet daher alle „Lustbarkeiten“ und rüstet zum Kampf gegen seine widerspenstigen „Untertanen“, die es wagen, wegen drückender Abgaben zu den Waffen zu greifen. Er befiehlt die Rekrutierung eines Söldnerheers, das Kommando über die etwa 3.000 Mann starke Truppe überträgt er dem berüchtigten böhmischen Heerführer Wenzel Morakhsy, der mit dem Titel „Generalobrist der niederösterreichischen Stände“ ausgestattet wird und am 10. Februar 1597 – die Aufständischen, unter denen sich auch viele Handwerker befinden, haben zwei Tage zuvor unter ihrem „Oberhauptmann“ Hans Markgraber Ybbs an der Donau erobert und rücken gegen Melk vor – den Auftrag erhält, vom Sammelpunkt Leitzersdorf aus mit seiner Truppe in Richtung Krems zur „Strafexpedition“ gegen die aufsässigen Bauern aufzubrechen. Die Männer Morakhsys sind kampferprobte Landsknechte, eine „Elitetruppe“, gegen die zu bestehen den schlecht bewaffneten und unerfahrenen „Rebellen“ unmöglich ist. Die Anführer der „Bauernhaufen“ wissen, dass ihnen damit ein Kampf auf Leben und Tod droht, viele ihrer Gefolgsleute ziehen es daher vor, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, andere vertrauen den sehr geschickten Unterhändlern des Erzherzogs, die all jenen Straffreiheit zusichern, die die Waffen niederlegen und friedlich nach Hause zurückkehren würden.
Nicht so die aufständischen Waldviertler, die von Andreas Schrembser, einem 75jährigen (!) Bauern aus Dobersberg, und einem Schmied namens Angerer geführt werden – man will, so der Plan, die Söldner in der Nähe von Langenlois zum Kampf stellen. Als man am 27. Februar erfährt, dass in Hadersdorf eine Abteilung Reiter Morakhsys eingetroffen ist, zögern sie daher nicht und greifen an: Es gelingt ihnen, die Söldner zu überraschen; 15 Soldaten werden getötet, die Bauern erbeuten 40 Pferde und zahlreiche Waffen. Der Jubel über den „Sieg“ währt jedoch nur kurz: Einige Reiter, die dem Überfall entkommen sind, benachrichtigen die Hauptabteilung von Morakhsys Kavallerie und diese nimmt nun blutige Rache für den Tod ihrer Kameraden: Die Bauern werden noch am selben Tag bei Straß im Straßertale gestellt und vernichtend geschlagen, etwa 200 Aufständische verlieren in dem Blutbad ihr Leben, die Überlebenden, unter ihnen auch Schrembser und Angerer, fliehen in die Weinberge; wer verdächtig ist, mit den „Rebellen“ zusammenzuarbeiten, wird kurzerhand am nächsten Baum gehängt oder man schneidet ihm Nase und Ohren ab; Straß und mehrere Dörfer werden von den Reitern Morakhsys niedergebrannt.
Schrembser und Angerer versuchen zwar, den Kampf wieder aufzunehmen, und erlassen noch einmal ein „Aufgebot“, ein Vorstoß auf Krems scheitert jedoch, ebenso der Versuch Markgrabers, St. Pölten zu erobern. Der Aufstand bricht Anfang April 1597 zusammen. Wenzel Morakhsy und seine Henker ziehen in der Folge eine blutige Spur durch das Land.
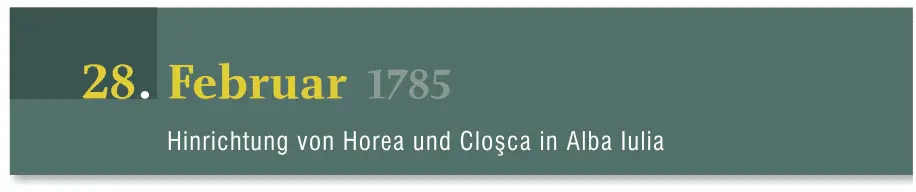
Der Horea-Aufstand
Er heißt eigentlich Vasile Ursu Nicolae, die Menschen in den Tälern des westkarpatischen Apuseni-Gebirges nennen ihn jedoch nur „Horea“ oder „Horia“. Er ist um 1740 im abgelegenen Dorf Albac geboren, Zimmermann und ursprünglich leibeigener Bauer gewesen, hat sich jedoch freikaufen können. Horea zimmert hölzerne Kirchen für die Siebenbürgener Dörfer und ist auch ansonsten ein wacher Geist, sogar beim Kaiser in Wien, so munkelt man, soll er schon gewesen sein, um für die Sache der rumänischen Bauern ein Wort einzulegen; er glaubt aus tiefstem Herzen daran, dass der „Reformkaiser“ sie nicht im Stich lassen werde. Als Joseph II. im Sommer 1784 eine Militär-Konskription zur Aufstellung neuer Grenzregimenter durchführen lässt, sieht Horea seine Stunde gekommen: Er erklärt seinen Landsleuten, dass jeder, der sich zum Dienst beim Militär melde, von der verhassten Leibeigenschaft – deren Aufhebung hatte Joseph ja schon 1781 verkündet – befreit sein werde und noch dazu ein Stück Land bekomme.
Die Beamten, die in Alba Iulia die Konskriptionslisten führen, sind zunächst schockiert – es dauert eine Weile, bis sie begreifen, dass sie die Bauern zurück auf ihre Höfe schicken müssen. Doch nun hat die Landbevölkerung bereits Unruhe erfasst: Die rumänischen Bauern halten sich für frei und verweigern den ungarischen Adeligen die Robot; Horea und zwei weitere Bauernführer, Gheorge Marcul, genannt Crişan, und Ion Orga, genannt Cloşca, rufen Versammlungen ein, schließlich kommt es Anfang November 1784 zum offenen Aufstand gegen die ungarischen Herren; Schlösser und Gutshöfe werden geplündert und in Brand gesteckt, zahlreiche Adelige ermordet – die Gutsherren rüsten daraufhin Banden aus, die auf eigene Faust gegen die Bauern Krieg führen, zahlreiche Gefangene werden hingerichtet. Die Aufständischen beweisen indes revolutionären Geist: Sie agieren mit gefälschten kaiserlichen Befehlen, die die Enteignung der Magnaten anordnen, ja, in seinem „Programm“ vom 1. November 1784 fordert Horea, dass „kein Adel mehr sein soll“ und ihre Besitzungen unter dem Volk verteilt werden sollen. Horea betont wieder, dass dies „in Gemäßheit eines erfolgenden Allerhöchsten kaiserlichen Befehls“ erfolgen müsse. In tragischer Verkennung ihrer Lage glauben Horea und seine Anhänger, mit diesen Forderungen den Willen des Kaisers auszuführen. Joseph II., der sehr wohl die „vielfältigen Bedrückungen“ der Gutsherren gegen die Bauern als Ursache des „Empörungsgeists“ erkennt, setzt nun Truppen gegen die Aufständischen ein, die in wenigen Wochen besiegt sind; Horea und Cloşca flüchten sich in die Wälder. Da 300 Dukaten Kopfgeld auf sie ausgesetzt sind, werden sie am 27. Dezember 1784 von Bauern aus Albac an die Häscher verraten; einen Monat später wird auch Crişan verhaftet.
Joseph II. kann seine Reformen in Siebenbürgen kaum durchsetzen, um die Bestrafung der gefangenen Bauern kümmert sich der Kaiser allerdings persönlich: 37 Todesurteile werden gefällt, 83 Aufständische kommen mit Gefängnisstrafen davon, 180 Bauern, die sich an den Plünderungen beteiligt haben, werden ausgepeitscht und anschließend freigelassen. Joseph II. zeigt guten Willen und begnadigt alle zum Tode Verurteilten mit Ausnahme von Horea, Cloşca und Crişan – an diesen „Bösewichtern“, so befiehlt er, muss ein „einprägsames Beispiel“ gegeben werden. Die Richter halten sich daran, auf die drei Bauernführer wartet, das 18. Jahrhundert neigt sich dem Ende zu, eine aus dem finsteren Mittelalter stammende Hinrichtungsmethode: Sie sollen gerädert und gevierteilt, ihre Körperteile zur Abschreckung an verschiedenen Orten öffentlich zur Schau gestellt werden. Crişan begeht aus Angst vor dieser Tortur im Gefängnis Selbstmord; Horea und Cloşca sterben am 28. Februar 1785 in Alba Iulia so, wie der Kaiser in Wien es will: bei lebendigem Leib mit dem schweren Rad in Stücke gehackt; sie sind noch nicht tot, als ihnen die Eingeweide herausgerissen werden. 2.500 Bauern, die man aus den Dörfern der Region zusammengetrieben hat, müssen zusehen, wie jene qualvoll zugrunde gehen, die ihnen noch vor wenigen Monaten die Befreiung aus der Leibeigenschaft verheißen haben. Joseph II. versucht in der Folge, die siebenbürgischen Bauern durch genaue schriftliche Festlegung ihrer Pflichten vor Willkür- und Racheakten des Adels zu schützen, so ordnet er etwa für das Komitat Zlatná, das Zentrum des Aufstands, die Herabsetzung der Handrobot an – die Großgrundbesitzer verstehen es allerdings, diese Anordnung zu verschleppen, bis zum Tode des Kaisers gibt es für die Bauern keine Erleichterung.
Читать дальше