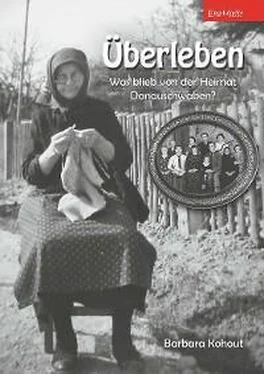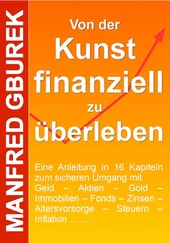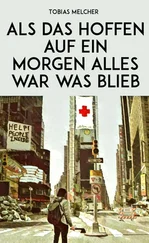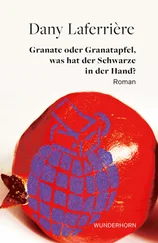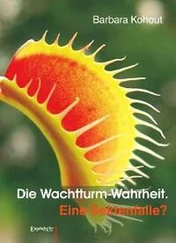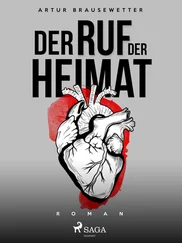1888 heiratete mein Ur-Großvater Michael die hübsche und reiche Kaufmannstochter Anna Elmer. Sie gehörte zu einer großen Familie. Anna und Michael galten als rechtschaffen und fleißig. Bereits 1889 kam mein Großonkel Peter zur Welt (donauschwäbisch: Petervetter). Das Mädchen, das 1891 geboren wurde, bekam der Tradition entsprechend den Namen Anna, nach den Vornamen der Großmutter und der Mutter. Der zweite Sohn, der ihnen 1893 geschenkt wurde, war mein Großvater Michael Englert. Ich werde Ata zu ihm sagen. Er bekam 1896 noch einen Bruder, Joseph. Meine Mutter nannte ihn Seppvetter .
Reformen im Schulwesen und Großvaters Start ins Leben
Ende des 19. Jahrhunderts setzte es sich die Regierung Weckerle zum Ziel, kirchenpolitische Reformen für das ungarische Gebiet durchzusetzen. Im Jahr 1892 verstaatlichte sie das Schulwesen, führte die Zivilehe ein und übertrug dem Standesamt die Bedeutung und Stellung des Matrikelamtes. Dieses hatte die Aufgabe, Geburten, Todesfälle und Eheschließungen zu beurkunden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle großen Lebensereignisse allein durch die Kirchen dokumentiert. Ferner führte Weckerle eine 6-jährige Schulpflicht ein. Die Unterrichtssprache und damit Schwerpunkt war ungarisch – auch für die deutschen Schulen. Die deutschen Kinder waren dadurch zunächst benachteiligt, denn sie konnten natürlich in der fremden Sprache dem Unterricht nur schwer folgen. Später allerdings erwies sich diese zusätzliche Anstrengung als Vorteil.
Mein Großvater besuchte von 1899 bis 1905 die Grundschule in Stanischitsch. Sein älterer Bruder Peter arbeitete zu dieser Zeit bereits im elterlichen Kolonialwarengeschäft. Auch sein Bruder Joseph wollte Kaufmann werden.
Mein Großvater hatte jedoch andere Pläne. Nach seiner Schulentlassung ging er in das 28 km entfernte Baja und begann eine Lehre als Frisör oder Balbier, wie es donauschwäbisch hieß.
Baja war ein pulsierendes Städtchen mit Theater und Künstlern, Geschäften und vielen fremden Besuchern. Dieses schillernde Leben gefiel meinem Großvater. Er liebte den Kontakt zu den Künstlern und dem Theater und schloss sich bald Laienspielgruppen an. Nach dem Abschluss seiner Lehrzeit machte er seine Meisterprüfung und übernahm 1911 einen Friseursalon. Gleichzeitig wurde er Maskenbildner am Theater und begann als Intendant, für Volkstheater Stücke einzustudieren.
Sein Geschäft florierte. Das lag nicht zuletzt an seiner offenen und leutseligen Wesensart. Auf diese Weise knüpfte er auch gute Beziehungen zu den oberen Gesellschaftsschichten. Bald beschäftigte er fünf Gesellen und einige Lehrlinge.
In dieser Zeit lernte er Rosalia Horváth kennen. Sie gehörte zu seinen Lehrmädchen. Das Mädchen hatte, trotz ihrer Jugend, bereits einige schwere Zeiten durchlebt. Sie wurde am 21.02.1901 geboren. Ihre Mutter starb im Wochenbett. Ihr Vater, ein Bürgerlicher, war Pfleger in einer Nervenheilanstalt. Um das Baby Rosalia kümmerten sich zunächst Pflegepersonen, die der Vater als Patienten in der Nervenheilanstalt betreute. Nach einigen Jahren heiratete er zum zweiten Mal und Rosalia bekam damit eine Stiefmutter. Diese behandelte das Kind sehr „stiefmütterlich“, wie der Volksmund sagt. Rosalie musste viel arbeiten und die jüngeren Geschwister versorgen. Und sie war ein zusätzlicher Esser am Tisch aus Sicht der Stiefmutter. Diese bestand darauf, dass sie sobald wie möglich wirtschaftlich selbstständig wurde. Rosalia weigerte sich jedoch trotzig und bestimmt, als Dienstmädchen zu arbeiten. Sie setzte durch, dass sie 1913, nach ihrem Schulabschluss, eine Lehre im Geschäft meines Großvaters machen konnte.
Das letzte Friedensjahr mündet in die Katastrophe
Die Familie Englert war im Jahre 1913 wohl situiert. Beruflich und privat lief alles bestens. Großvaters ältere Schwester heiratete ihren Verlobten Nikolaus Bleilinger. Es war eine gute Partie. Entsprechend wurde eine standesgemäße, große Hochzeit im besten Gasthaus des Ortes gefeiert. Alle Honoratioren der Gemeinde waren geladen. Großvater leitete das Fest. Er hatte einige lustige Sketche einstudiert und spielte auch zusammen mit der Kapelle auf seiner Ziehharmonika zum Tanz auf. Man war ausgelassen und fröhlich, wie Menschen nur sein können, denen eine glückliche Zukunft in Aussicht steht. Dem Ansehen der Familie entsprechend wurden Speisen und Getränke serviert, dass sich die Tische bogen.
Wenige Monate später, im Juli 1914, fielen in Sarajewo die verhängnisvollen Schüsse, die auch für Stanischitsch nicht ohne traumatische Folgen blieben.
Der österreich-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz-Ferdinand und dessen Frau, Herzogin Sophie von Hohenberg, wurden getötet.
Am 28. Juli erklärte Österreich-Ungarn daraufhin Serbien den Krieg. Hunderttausende Soldaten und ebenso viele Zivilisten verloren in diesem Konflikt, der später den Namen Erster Weltkrieg bekommen sollte, ihr Leben. Ganz zu schweigen von dem immensen Verlust von materieller Habe und geistigen Werten. Es war eine Zeit, die die Welt nachhaltig verändern sollte.
Nur ein unverbesserlicher Optimist dehnt in solchen Zeiten seine Geschäfte aus. Mein Großvater war einer von ihnen. Obwohl 1917 die meisten jungen Männer inzwischen im Krieg und an der Front waren, übernahm er einen weiteren Friseursalon. Zur Geschäftsführerin machte er die blutjunge Rosalia (kurz: Roschi). Sie war gerade 16 Jahre alt, aber unermüdlich fleißig, tüchtig und zuverlässig und ersetzte durchaus einen jungen Mann.
Ein weiteres Interesse verband die beiden: Auch sie war mit Feuereifer dabei, wenn Theater gespielt wurde. Singen und Tanzen hatte sie als Ungarin quasi im Blut. Es dauerte nicht lange, und sie war in ihren attraktiven Chef bis über beide Ohren verliebt. Mein Großvater war diese Zuneigung durchaus recht. Aber an eine Heirat dachte er zunächst nicht. Es war Krieg. Wer konnte wissen, wie lange er die Läden noch selbst leiten konnte? Auch spürte man zunehmend die wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Männer waren im Krieg. Das Geld der Kunden wurde knapp. Die Frauen hatten andere Sorgen, als zum Frisör zu gehen.
Am 5. Juni 1918, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, heiratete Joseph Englert, der kleine Bruder meines Großvaters, Eva Martin. Sie war verwandt und verschwägert mit dem Ziegeleibesitzer, dem Mühlenbesitzer und dem reichen Schneidermeister – also eine wirklich gute Partie. An diesem Tag gab mein Großvater seine Verlobung mit Rosalia bekannt. Die betuchte Verwandtschaft war, wie zu erwarten, wenig erfreut darüber. Eine Horváth ohne Adel und ohne Vermögen – wie konnte er nur!? Die Stimmung war gereizt: „Du wirst doch nicht diese Schlawakin (die Ungarin) heiraten wollen!“ Die reichen Donauschwaben fühlten sich den einheimischen Ungarn und Serben weit überlegen.
Rosalia hatte meinen Großvater auf das Fest begleitet. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass sie tief verletzt war. Sie spürte die Verachtung der Familie. Wie mir später erzählt wurde, hielt sie sich die meiste Zeit abseits von den Gästen. Sie konnte sich nur schwer verständigen. Ihre Deutschkenntnisse waren mangelhaft. Aber es entging ihr trotzdem nicht, dass es offenbar um sie ging und dass die Kommentare ihr gegenüber wenig freundlich waren.
Die Stimmung war aus einem weiteren Grund gedrückt: Mein Urgroßvater war gefallen. So kam diese Hochzeit auch aus rein praktischen Erwägungen zustande: Eva sollte ihre verwitwete Schwiegermutter im Geschäft entlasten. Das Leben musste irgendwie weitergehen. Nach der Hochzeit wurde das Geschäft auf das junge Paar überschrieben.
Der Dritte der Brüder, Peter, heiratete die Tochter eines Viehhändlers und übernahm das Geschäft seiner Schwiegereltern. Auch er war nun gut situiert. Umso mehr glaubte sich die Familie im Recht, wenn sie den Michl wegen seiner scheinbaren Torheit kritisierten.
Читать дальше