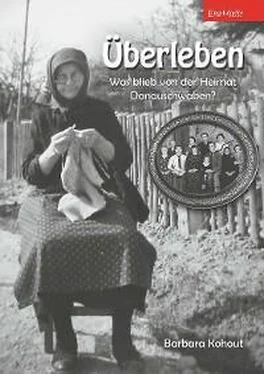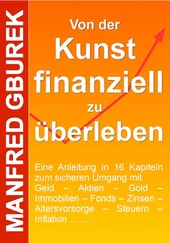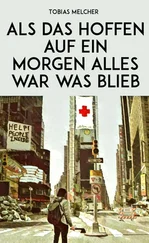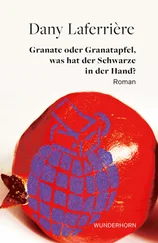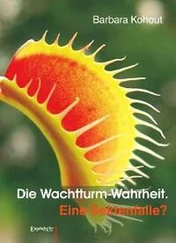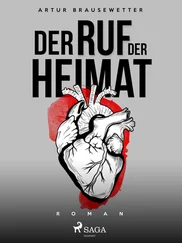Ich erinnere mich an einen weiteren verborgenen Schatz. Vor vielen Jahren schenkte mir eine Tante das Buch des Heimatforschers Michael Hutfluss, das er dem Geburtsjahrgang 1939 widmete: das Ortssippenbuch Stanischitsch, Batschka 1896 – 1938. Es enthält die gesamten Einträge aus den Matrikelbüchern von Stanischitsch von 1788 bis 1938. Auch meine Geburt ist darin verzeichnet. Damals schätzte ich das Geschenk nicht sonderlich. Ich erwartete ja den baldigen Untergang des gesamten weltlichen Systems der Dinge, wie der Weltuntergang in der Wachtturm-Sprache genannt wird. Aber jetzt interessiert mich die Geschichte meines Geburtsortes sehr. Aus diesen Aufzeichnungen erhalte ich nun Auskunft über meinen Stammbaum.
Die ersten Donauschwaben folgten offenbar dem Aufruf der Kaiserin Maria Theresia, Siedler für ihr südliches Herrschaftsgebiet anzuwerben. Zunächst wurde das Banat mit den Ankömmlingen besiedelt.
Maria Theresia beendete ihr Siedlungsprojekt 1772. Joseph II. setzte mit einem Erlass 1781 die Siedlungspolitik seiner Mutter fort. Er erlaubte ausdrücklich auch Protestanten, in seinem Gebiet zu siedeln. Damit hielt er sich an die Vereinbarungen, die mit dem Westfälischen Frieden getroffen worden waren, und garantierte Religionsfreiheit.
In dieser Zeit trafen die ersten Siedler aus deutschen Landen in Stanischitsch ein. Der Name des Ortes ist serbischen Ursprungs: Stanìsić. Obwohl der Ort in Ungarn liegt, gehörte dieses Gebiet schon im 18. Jahrhundert zur Donaumonarchie. Im Buch verwende ich durchgehend die deutsche Schreibweise Stanischitsch. Sie ist die jetzt in Deutschland gebräuchliche unter den ehemaligen Ortsansässigen.
Zu den ersten Ankömmlingen in Stanischitsch gehörte offenbar auch ein Ehepaar namens Paul und Hedwig Englert mit ihrer 3-jährigen Tochter Emma. Bis zum Jahr 1786 gab es schon 100 von deutschen Neubürgern gebaute Häuser. Die Zuwanderer waren vorwiegend katholischen Glaubens. Für die Protestanten gründete man eine eigene Ansiedlung.
Vor meinem inneren Auge zieht eine vertraute und doch fremde Landschaft vorbei, während ich weitere Einzelheiten über die Ereignisse rund um die Entstehung meines Geburtsortes lese: Er liegt im sogenannten Bajaer Dreieck. Es ist südliches Grenzgebiet zwischen Ungarn und dem heutigen Serbien zwischen Donau und Theiß. Das Bajaer Dreieck ist ein Landstrich mit einer wechselvollen Geschichte.
Als im Jahre 1713 die junge Habsburgerin Maria Theresia zur Thronfolgerin Karls VI. ernannt wurde, war die Region ein dünn besiedeltes Brachland. Die Osmanen waren zwar besiegt und vertrieben, aber das Land war auch entvölkert. Es wurde hauptsächlich als Weideland für die staatlichen Kriegspferde genutzt.
Maria Theresia hatte ehrgeizige Pläne. Sie wollte ihre Besitzungen gewinnbringend verwalten. Dazu brauchte sie Bauern für die Besiedelung und sie musste ihre Staatsgrenzen gegen feindliche Übergriffe schützen. Dafür brauchte sie Soldaten. Im Vertrag von Belgrad von 1739 konnte Maria Theresia für dieses Gebiet den Frieden sichern. Es war nun fester Bestandteil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Sie bestimmte, dass die Amtssprache fortan Deutsch sei.
Am 20. März 1763 erließ die Kaiserin das Edikt zur Besiedelung dieser Besitzungen. Ihr Interesse galt vorwiegend dem fruchtbaren Landstrich Banat. Sie erklärt ihre Absicht, „die ‚ fundi contributionalis‘“ (Einnahmequellen) zu vermehren und Rekruten zu verpflichten. Daher seien “deytsche Colonisten katholischen Glaubens“ zu bevorzugen. Gegen “Raitzisches“ Volk (serbische Einwohner) bestünden Bedenken. Damit waren vermutlich die Vertriebenen aus den Gebieten Barasca und Dautovo in Ungarn gemeint. Die Ungarn hatten sie vertrieben, weil sie in diesen Städten selbst siedeln wollten. Die Vertriebenen flüchteten in die ungarische Pusta und begannen, neue Häuser zu bauen. Möglicherweise hieß der Anführer dieser Gruppe Stani. Daraus entstand das Dorf Stanischitsch. Bereits nach fünf Jahren lebten dort 88 serbische Familien, die das ausgedehnte Weideland der Kriegspferde auch für ihr Hornvieh und ihre Schafe nutzten.
Zu dem Zeitpunkt, als Maria Theresia ihr Siedlungsprojekt beendete, hatten die Serben ihre Häuser bereits westlich der späteren Hauptstraße errichtet. Dort hatten sie genügend Wasser für ihre Brunnen und Schilfrohr für die Dächer. In der „Großen Gasse“ standen ihr Gemeindehaus und eine kleine, niedrige Bretterkirche, die mit einem Rohrdach gedeckt war. Bereits 1806 wurde diese durch einen Neubau ersetzt, der komplett in Eigenleistung der Gemeindemitglieder errichtet wurde. Neben der Kirche war die Schule. Es war ein typisches Siedlerdorf mit kleinen Häusern, deren Wände aus gestampftem Lehm errichtet wurden. Die Dächer waren ebenfalls mit Schilfrohr gedeckt. So ein Siedlungshaus haben meine Eltern gemietet.
Die Menschen identifizierten sich mit ihrem Dorf. Das Leben verlief wieder so, wie sie es gewohnt gewesen waren. Man tat seine Arbeit. Man feierte die Feste des Jahres und der Familie. Man pflegte die alten Traditionen. Die persönlichen Bedürfnisse konnten befriedigt werden. Sicher gab es Spannungen und Probleme. Aber insgesamt war es eine vergleichsweise friedliche und glückliche Zeit.
Der Beginn des 19. Jahrhunderts brachte Europa große politische Umbrüche. Die Napoleonischen Kriege zerstörten weite Teile des Kontinents. Die politischen Hoffnungen, die mit Napoleons Herrschaft verbunden gewesen waren, wurden schnell enttäuscht. Die dunklen Wolken am politischen Himmel gingen auch an der Regentschaft der Habsburger nicht vorüber. Und sie betrafen auch meine Vorfahren.
Mein Ur-Ur-Ur-Großvater beschloss, der Enge und den begrenzten Möglichkeiten seiner Heimat im Schwäbischen zu entkommen und in der Ferne ein neues Leben zu beginnen. Er ließ sich von den Gesandten Josephs II. anwerben und fand sich bei einem der vorgesehenen Sammelplätze ein. Von Ulm oder Regensburg aus wurden alle, die umsiedeln wollten, mit einer der sogenannten „Ulmer Schachteln“ auf der Donau bis Österreich verschifft.
Der ältere Bruder meines Urahns hatte den Hof der Familie in Schwaben gerbt. Wie es zu jener Zeit nicht selten war, blieb nur der Erbe auf dem Stammsitz der Familie. Der jüngere Bruder wollte unter keinen Umständen Knecht bei seinem Bruder werden. Die beiden Schwägerinnen sorgten durch eifersüchtige Streitereien auch für Unfrieden und ständige Spannungen, die die Brüder allmählich leid waren. So entschloss sich der Jüngere, mit seinem Erbteil eine eigene Existenz zu gründen. Der Ältere musste ihm das Erbe ausbezahlen.
Paul und Hedwig Englert mit Tochter Emma schlossen sich den Aussiedlern an. Gemeinsam mit ihnen verließ auch der jüngste Bruder die Heimat. Er wollte den französischen Werbern nicht in die Hände fallen, die unter den Bauernsöhnen Soldaten für Napoleon rekrutierten. Da er noch ledig war, blieb er in der Familie seines Bruders. Das erwies sich als Glück für beide.
Erst in Wien erfuhren die Siedler ihren endgültigen Zielort. Die Reise war nicht billig. Zunächst wurden nur Bewerber zugelassen, die mittleren Alters, bei guter Gesundheit und bestimmten Berufen zugehörig waren. Außerdem mussten sie 100 Gulden als Vermögen nachweisen. Im späteren Verlauf der Umsiedlung wird allerdings davon berichtet, dass man auch Siedler akzeptierte, die kein Vermögen hatten.
Die deutschen Herrscher hatten kein Interesse an der Ausreise der wohlhabenden Bauern. Sie war unter Strafandrohung streng verboten. Wer einen Ausreisewilligen zur Anzeige brachte, erhielt eine Belohnung. Der Delinquent dagegen verlor seinen gesamten Besitz.
Im Ankunftsgebiet erhielten alle die gleichen Starthilfen und Zuteilungen. Diese beinhalteten Ackerland, Wiesen, Hilfen zur Errichtung der Häuser, Saatgut für das erste Jahr und die Anschaffungen für Zug- oder Masttiere. Es wurden auch sogenannte Reisespesen von 6 Gulden ausbezahlt und für Unterkunft und Verpflegung gesorgt, bis die Selbstversorgung gesichert war.
Читать дальше