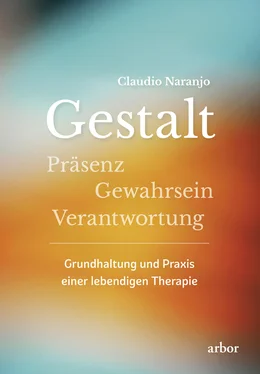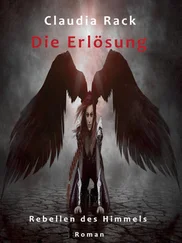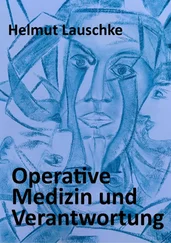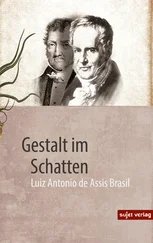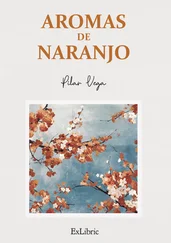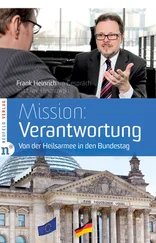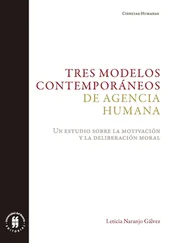Die Gestalttherapie hat im Gegensatz zur Psychoanalyse wenig zur dynamischen Interpretation psychopathologischer Phänomene hinzuzufügen. Sie ist mehr Therapie als Theorie, mehr Kunst als psychologisches System. Dennoch hat die Gestalttherapie durchaus eine philosophische Grundlage. Die oben beschriebenen Grundhaltungen sowie ihre dreifache Prämisse bilden eine philosophische Basis der Gestalttherapie. Mehr noch: Die Gestalttherapie beruht auf einer impliziten philosophischen Orientierung, die vom Therapeuten an den Patienten oder den Auszubildenden ohne die Notwendigkeit weiterer Erläuterungen weitergegeben wird. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, daß die Erfahrung und Übernahme solcher impliziten Weltsichten ein verborgener Schlüssel für den therapeutischen Prozeß sind. Dies führt zu der Überzeugung, daß eine spezifische Lebensphilosophie der Hintergrund der Gestalttherapie ist, ebenso wie eine spezifische Psychologie zur psychoanalytischen Therapie gehört.
Die Übertragung der Haltungen wie die oben beschriebenen durch den Gebrauch der Werkzeuge, die für die Gestalttherapie charakteristisch sind, kann mit dem Prozeß verglichen werden, durch den ein Bildhauer mit den Werkzeugen seiner Kunst eine Form gestaltet. In beiden Fällen transzendiert der Inhalt die Werkzeuge, obwohl diese eigens für diesen Ausdruck konzipiert wurden. Unglücklicherweise ist es eine unserer menschlichen Schwächen, darauf zu vertrauen, daß Formeln und Techniken alles für uns leisten können. Diese immerwährende Versteinerung der Wahrheit in starren Formeln können wir in der Geschichte aller Kulte und Sekten beobachten.
Wenn ich die Philosophie der Gestalttherapie „implizit“ nenne, sage ich nicht, daß sie wie in der Psychoanalyse „verdeckt“ ist. Sie ist einfach implizit, was auf die Natur ihres Gehalts zurückzuführen ist: Der Gestalttherapeut legt mehr Wert auf Taten als auf Worte, auf Erfahrungen statt Gedanken. Er vertraut auf den lebendigen Prozeß der therapeutischen Interaktion und den inneren Wandel, der daraus resultiert, statt auf die Beeinflussung der Überzeugungen. Handeln zieht Substanz nach sich und berührt sie. Ideen sind flüchtig und können leicht die Realität verdecken oder sie sogar ersetzen. Nichts könnte der Gestalttherapie ferner liegen als zu predigen. Dennoch beinhaltet sie eine Art Überzeugungsarbeit, frei von Befehlen und Glaubenssätzen – so, als würde ein Künstler seine Weltsicht und seine Orientierung bezüglich des Seins durch seinen Stil zum Ausdruck bringen.
Ideen sind als Ersatz für echte Erfahrungen ebenso gefährlich wie Techniken, denn sie sind durch ihre Klarheit und ihre deutlichen Grenzen für uns verführerisch. Wir sind geneigt, in die „magische“ Falle der Gleichsetzung von Wissen und Sein, Verständnis und Handeln, Äußerung und Wirkung zu gehen. Dennoch haben wir nichts als Ideen und Techniken, und wir müssen akzeptieren, daß das, was uns dient, uns ebenso in den Schlaf führen und unseren Platz einnehmen kann.
Moral jenseits von Gut und Böse
„Gut“ und „Böse“ sind für den Gestalttherapeuten verdächtige Begriffe, denn er ist gewöhnt, die meisten menschlichen Handlungsanweisungen als subtile Manipulationen zu sehen, ebenso, wie er Diskussionen über moralische Themen als Selbstrechtfertigungen und Rationalisierungen von Bedürfnissen sieht, Aussagen über Wert und Unwert als Verallgemeinerungen und Projektionen persönlicher Erfahrungen auf die Umwelt als Versuch, Verantwortung für die eigenen Gefühle und Reaktionen zu vermeiden.
Fritz Perls drückte dies folgendermaßen aus:
Gut und Böse sind Reaktionen des Organismus. Wir sagen: „Du machst mich wahnsinnig“, „Du machst mich glücklich“ und weniger oft: „Du machst mir gute Gefühle“ oder: „Du machst mir schlechte Gefühle“. Bei den Naturvölkern sind solche Aussagen äußerst häufig. Immer wieder sagen wir: „Ich fühle mich gut“ oder „Ich fühle mich miserabel“, ohne uns zu überlegen, woher das Gefühl kommt. Tatsache ist, daß ein eifriger Schüler dem Lehrer ein gutes Gefühl gibt, ebenso wie das folgsame Kind den Eltern. Der siegreiche Boxer schenkt seinem Fan ein gutes Gefühl, ebenso wie der zärtliche Liebhaber seiner Geliebten. Ein Buch oder ein Bild tut dasselbe, wenn es unseren ästhetischen Bedürfnissen entspricht. Umgekehrt: Wenn Menschen oder Gegenstände unseren Bedürfnissen nicht entsprechen und uns nicht befriedigen, fühlen wir uns ihretwegen schlecht.
Der nächste Schritt besteht darin, daß wir unsere Erfahrungen, statt sie uns anzueignen, nach außen projizieren und die Verantwortung für unsere Reaktionen auf den Reiz abschieben. (Das liegt möglicherweise daran, daß wir Angst vor unserer eigenen Erregung haben, fürchten, wir könnten vor Aufregung versagen, und uns vor unserer Verantwortung drücken wollen und so weiter.) Wir sagen, der Schüler, das Kind, der Boxer, der Liebhaber, das Buch, das Bild „sind“ gut oder schlecht. In dem Augenblick, in dem wir den Reiz als „gut“ oder „böse“ einordnen, schließen wir das „Gut“ und das „Böse“ aus unserer eigenen Erfahrung aus. Sie werden zu Abstraktionen, und der Gegenstand des Reizes wird folglich erst einmal beiseitegelegt. Dies bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Wenn wir erst einmal unser Denken vom Fühlen, unser Urteil von unserer Intuition, unsere Moral von unserem Selbstgefühl, unser beabsichtigtes von unserem spontanen Handeln, das Verbale vom Nonverbalen getrennt haben, verlieren wir unser Selbst, die Essenz des Seins, und werden entweder zu frigiden menschlichen Robotern oder zu verwirrten Neurotikern. 7
Trotz solcher Sichtweisen von Gut und Böse steckt die Gestalttherapie voller Empfehlungen bezüglich erwünschter Einstellungen dem Leben und der Erfahrung gegenüber. Dies sind moralische Vorschriften, denn sie beziehen sich auf eine gute Lebensführung. Obwohl der Begriff der Moral im gewöhnlichen Sprachgebrauch auf das Bemühen hinweist, gemäß der dem Menschen intrinsischen Maßstäbe zu leben, ist es möglich, daß alle großen moralischen Themen einst einer humanistischen Ethik entstammten, in der Gut und Böse nicht aus den menschlichen Lebensumständen herausgelöst waren. Daher wies der Begriff der Rechtschaffenheit im Judentum, jener eminent gesetzestreuen Religion, auf Lebensumstände hin, die sich im Einklang mit dem Willen und Gesetz Gottes befanden. Im nontheistischen China würde dies dem „Tao“ entsprechen, dem Befolgen des rechten Weges. Es scheint, daß das, was in einer lebendigen Vision des Lebens als richtig, gerecht, angemessen oder gut gesehen wird, sich gegen den Menschen richtet, nachdem es in Gesetzen ausgedrückt wird und ihn versklavt, indem es eine Autorität beansprucht, die größer ist als er selbst. Wenn wir die impliziten moralischen Ansprüche der Gestalttherapie auflisten, können wir eine lange oder eine kurze Liste anfertigen, je nachdem, wie allgemein oder speziell man in seiner Analyse ist. Ohne den Anspruch, systematisch oder vollständig zu sein, hier ein grober Überblick über den Lebensstil der Gestalttherapie:
1. Lebe jetzt: Befasse dich mit der Gegenwart, statt mit der Vergangenheit oder der Zukunft.
2. Lebe hier: Setze dich mit dem Gegenwärtigen, statt mit dem Abwesenden auseinander.
3. Hör auf, deiner Einbildung zu folgen: Erfahre das Wirkliche.
4. Stoppe unnötige Gedanken, öffne statt dessen deine Sinne, deinen Geschmack und deine Augen.
5. Drück dich aus, statt zu manipulieren, zu erklären, zu rechtfertigen und zu beurteilen.
6. Laß dich auf Unangenehmes und Schmerzen ebenso ein wie auf Angenehmes. Begrenze nicht dein Gewahrsein.
7. Akzeptiere kein „Sollte“ oder „Müßte“, wenn es nicht von dir selbst kommt. Verehre keine Götzen.
8. Übernimm die volle Verantwortung für dein Tun, dein Fühlen und dein Denken.
Читать дальше