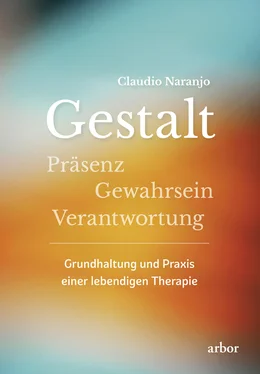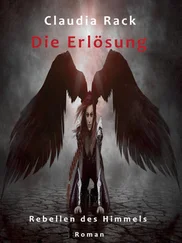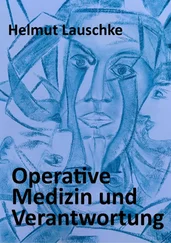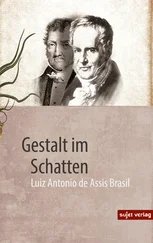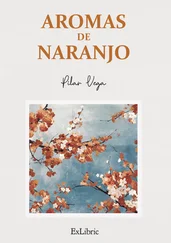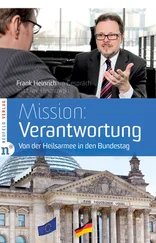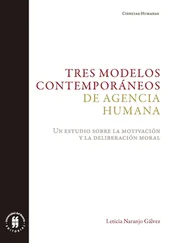1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 9. Gib dich so, wie du bist, dem Sein hin.
Das Paradox, daß solche Handlungsvorgaben Teil einer Moralphilosophie sein können, die sämtliche Handlungsvorgaben aufzugeben empfiehlt, kann gelöst werden, wenn wir sie als Aussagen über den Status quo, statt als Pflichten sehen. Verantwortung zum Beispiel ist kein Muß, sondern eine unvermeidliche Tatsache. Wir sind für alles, was wir tun verantwortlich. Die einzige Alternative ist, unsere Verantwortung anzunehmen oder nicht. Alles, was die Gestalttherapie dazu sagt, ist, daß man, indem man die Wahrheit akzeptiert – was eher auf ein Nicht-Verändern als auf ein Tun hinausläuft –, das Richtige tut: Gewahrsein heilt. Natürlich heilt es uns von nichts anderem als von unseren Lügen.
Ich glaube, daß all diese spezifischen Anweisungen der Gestalttherapie unter die drei allgemeineren Prinzipien untergeordnet werden können, die bereits oben vorgestellt wurden:
1. Sinn für das Gegenwärtige (zeitlich gegenwärtig, statt vergangen oder zukünftig), räumlich (anwesend, statt abwesend) und substantiell (Handlung, statt Symbol)
2. Sinn für das Gewahrsein und die Akzeptanz der Erfahrung
3. Sinn für das Ganze oder Verantwortung
Diese drei Punkte lediglich als technische Gesichtspunkte oder therapeutische Mittel zu sehen, hieße, ihre Rolle zu unterschätzen. Stellen Sie sich beispielsweise eine Interaktion wie die folgende vor, die für eine Gestalttherapiesitzung nicht außergewöhnlich ist:
Über das Gegenwärtige
P.: Ich war gestern sehr deprimiert …
T.: Wie es ausschaut, fängst du an, mir eine Geschichte zu erzählen.
P.: Stimmt … Es ist wahr, daß ich jetzt nicht deprimiert bin, aber ich dachte, es könnte gut sein, zu verstehen, was passiert ist; sonst mache ich mir Sorgen, daß es das nächstemal …
T.: Siehst du, wie du dir Sorgen machst?
P.: Nun, wenn ich nicht über meine Zukunft nachdenken soll, was tue ich dann hier?
T.: Laß uns das mal herausfinden.
Oder stellen Sie sich folgenden Dialog über die Verantwortung vor:
P.: Ich bin ganz ängstlich, weil ich fühle, daß Sie erwarten, daß ich irgend etwas erzähle …
T.: So? Tue ich das?
P.: Nun, ich stelle mir das vor … oder vielmehr, ich würde Ihnen gerne gefallen oder einen guten Eindruck machen … obwohl ich das eigentlich nicht sollte.
T.: Wer sagt das?
P.: Ich möchte mich eigentlich gern ganz anders fühlen. Es führt dann dazu, daß ich mich ganz schwach fühle.
T.: Was führt dazu?
P.: Ich selbst mache mich schwach. Ich schrumpfe und werde ganz klein. Es ist, als würde ich den Strom ausschalten.
T.: So machen Sie sich also selbst ängstlich …
P.: Ja, das mache ich. Ich habe die Wahl …
Ich habe das Gefühl, dies sind die Fälle, in denen die Interaktion des Therapeuten als praktische Demonstration für den Wert oder das Verdienst einer Lebensphilosophie gelten kann. Sehr häufig wird es nur einen speziellen Aspekt im Leben betreffen, aber die Konsistenz der Perspektive wird eine allmähliche Weiterentwicklung der persönlichen Überzeugungen bewirken. Ein Patient kann beispielsweise experimentell herausfinden, daß die Gefühle, die er vermieden hat, sich verwandeln, wenn er sich mit ihnen auseinandersetzt, daß sie sich verändern, wenn er sie akzeptiert, während sein gewöhnliches Abwehrverhalten sie nur noch verstärkte. Oder er entdeckt in dem Prozeß absichtlichen „Vergessens“ vergangener und zukünftiger Sorgen zu seinem großen Erstaunen, daß er nicht immerzu an ihnen festhalten muß, sondern tatsächlich mit dieser neuen Einstellung nicht etwa schlechter, sondern besser zurechtkommt. Diese Art von Interaktion hat eine Parallele im Zen:
Sengtsan befragte Huike. Er sagte: „Es geht mir so schlecht: Ich flehe dich an, wasch mich von meinen Sünden rein.“ Huike erwiderte: „Bring mir deine Sünden, und ich werde dich von ihnen reinigen.“ Sengtsan dachte eine Weile nach und sagte dann: „Ich kann sie nicht fassen.“ Huike antwortete: „Dann habe ich dich schon von ihnen gereinigt.“
Mehr als Haltung: direkte Erfahrung
Die Grundhaltung, sich auf das Gegenwärtige und die eigene Präsenz einzulassen sowie Gewahrsein und Verantwortung zu zeigen, entwickeln sich – so, wie das weiße Licht zu den Farben des Regenbogens gebeugt wird – zu den spezifischeren Haltungen oder Idealen, die das Verhalten des Gestalttherapeuten in der Praxis inspirieren. Jede dieser spezifischen Haltungen oder impliziten Gebote leitet sich aus der dreifachen Grundhaltung ab, deren drei Aspekte verschiedene Ausdrucksformen eines einzigen Gesetzes sind. Doch wäre es nicht zutreffend, ihre Ableitung in rein logischen Kategorien zu sehen, wenngleich ihre Verwandtschaft in logischen Begriffen aufgezeigt werden kann.
Wenn ich von „Grundhaltung“ spreche, habe ich in der Tat zuwenig Betonung auf die Erfahrungsgrundlage des Verhaltens oder der Prämissen gelegt, die weiter oben beschrieben wurden. Der Begriff „Haltung“ ist insofern angebracht, als er eine allgemeine Reaktion beschreibt. Er deutet auf eine bestimmte Lebensphilosophie und auf Verhaltensaspekte hin. Es sollte jedoch klargestellt werden, daß das Erlernen der Einstellungen, die ich als den zentralen Prozeß in der Gestalttherapie darstelle, nicht.als eine Veränderung des individuellen Glaubenssystems oder als eine Imitation eines bestimmten Verhaltens gesehen werden darf. Der Inhalt der Vermittlung, die in der Psychotherapie stattfindet, besteht nicht aus Ideen oder Verhaltensstilen, sondern in einer Erfahrung, aus der sowohl Ideen als auch Verhalten resultieren können – keine Beschreibung, sondern die Erfahrung von Präsenz, Gewahrsein, Verantwortung, in der Gewißheit, grundsätzlich gut zu sein, und mit einem Blick für die Möglichkeiten anderer. Jemand, der ist, kann nicht nur auf seinen eigenen Beinen stehen, sondern er kann auch das Wesentliche sehen, wonach andere streben und dabei ihre Energie verschwenden, weil sie ihre Suche falsch angehen. Er muß dazu nicht eine bestimmte Einstellung übernehmen. Er erfährt sich selbst als der Existenz würdig und erlebt so auch seine Mitmenschen. Ebenso wie der Therapeut für sich selbst da ist, so ist er auch für den Patienten da, nicht etwa gegen ihn, sondern lediglich desinteressiert an den Spielchen, die das Wesentliche verdecken.
Es ist offensichtlich, wenn man sagt, daß der Lernprozeß, der in der Gestalttherapie stattfindet, auf Erfahrung basiert, statt auf intellektueller Erkenntnis, und über bloße Verhaltensrichtlinien hinausgeht. Wenn dies der Fall ist, dann kann man zu Recht sagen, daß der therapeutische Prozeß aus der Vermittlung einer Erfahrung besteht . Über die Psychotherapie als Technik ist viel geschrieben worden – jedenfalls vom Standpunkt der Einwirkungen oder Interpretationen des Therapeuten auf den Patienten. In derartigen Beiträgen werden die Erfahrungen des Patienten immer als durch bewußte Entscheidungen des Therapeuten hervorgerufen beschrieben. Was jedoch dabei ausgelassen wird, ist die Vorstellung, daß Erfahrungen weitergegeben werden können und daß, da aus Lebendigem wiederum Lebendiges hervorgeht, eine bestimmte Tiefe der Erfahrung möglicherweise nur durch die Präsenz eines anderen herbeigeführt werden kann, der an dieser Tiefe teilhat, und nicht durch Manipulationen. Wenn die Grundhaltung mehr ist als eine Technik, und wenn Techniken aus Haltungen hervorgehen, dann ist die Erfahrung eine Voraussetzung für eine bestimmte Haltung, ihre Quelle. Ohne die angemessene innere Haltung werden Techniken zu Leerformeln. Ohne Erfahrung wird selbst eine Haltung zum Dogma aus zweiter Hand. Ebenso wie ein toter Organismus sich nicht selbst reproduzieren kann, kann die leblose Form einer Pseudo-Haltung keine entsprechende Haltung in einem anderen erzeugen. Erfahrung jedoch vervielfältigt sich von selbst. Sie erzeugt die äußere Gestalt, die ihr pulsierendes Herz überträgt.
Читать дальше