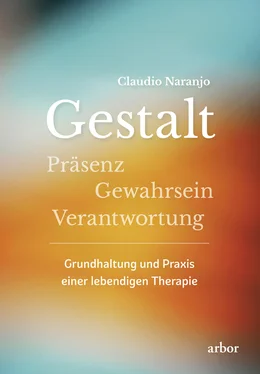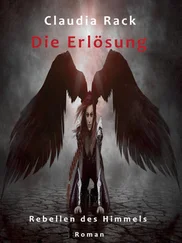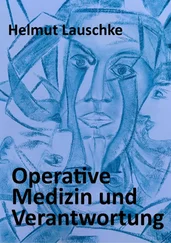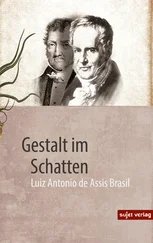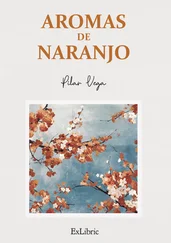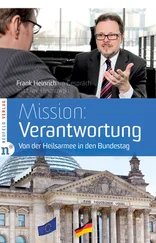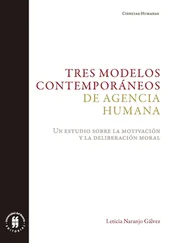Als ich in den späten sechziger Jahren nach einem besseren Verständnis der „theoretischen Grundlagen“ der Gestalttherapie suchte, wendete ich mich an Gene Sagan (über den Fritz in den frühen Sechzigern sehr begeistert war und der dessen Verbindung zum Esalen Institut hergestellt hatte). Überraschenderweise sagte er mir, daß er der Meinung sei, daß die Gestalttherapie mehr mit der Stanislawski-Schule des Schauspiels zu tun habe als mit der Gestaltpsychologie. Ich stimme in dieser Beziehung noch immer mit ihm überein. Ebenso vertrat ich auf der Konferenz in Baltimore die Auffassung, daß Fritz eine wissenschaftliche Untermauerung der Gestalttherapie erst dann suchte, als er sie gegen akademische Kreise verteidigen mußte.
Ich bin weit davon entfernt, theoriefeindlich eingestellt zu sein, und habe erhebliche Einwände gegen die anti-intellektuelle Einstellung Fritz Perls’, die von vielen anderen übernommen wurde. Wenn die Gestalttherapie überhaupt eine Theorie braucht, dann ist sie nicht in einer Sammlung von Fritz Perls’ persönlichen Auffassungen zu finden, wie etwa: „Angst ist Erregung minus Atem“ oder: „zu sterben und wiedergeboren zu werden ist nicht einfach“, so tiefschürfend diese auch sein mögen. Der Psychotherapeut kann einen weitaus größeren Nutzen aus einem Verständnis der Psyche und des Wachstumsprozesses ziehen, als aus einer trockenen, spezifischen Gestalttheorie. Zumindest persönlich bin ich eher an einer Theorie von Gesundheit und Krankheit interessiert (um es anspruchsvoller auszudrücken: eine Theorie von Erleuchtung und Verdunkelung), die nicht nur die Inspirationen der Gestaltpsychologie zusammenbringen würde, sondern auch all das, was wir über Prägung, Psychodynamik und darüber hinaus über die Einflüsse der östlichen spirituellen Traditionen wissen.
Weniger ehrgeizig als ein solch umfassendes Unterfangen und dennoch relevanter als Paul Goodmans Versuch Mitte der fünfziger Jahre (jene „Gestalttheorie“, die durch die gegenwärtig sich entwickelnde Orthodoxie in der Gestalttherapie vereinnahmt wird) wäre eine „Theorie der Gestalttherapie“ – ein Vorhaben, vergleichbar mit der Theorie einer psychoanalytischen Therapie, die sich seit einiger Zeit als Alternative zur psychoanalytischen Theorie des Geistes entwickelt hat. Darüber habe ich in diesem Buch berichtet, ohne dies jedoch in den Vordergrund zu stellen, und meine Sicht kann in folgender Formel zusammengefaßt werden:
Gestalttherapie =(Gewahrsein/Natürlichkeit + Verstärkung/Konfrontation) Beziehung
In anderen Worten: Der therapeutische Prozeß beruht auf der Seite des Patienten auf zwei transpersonalen Faktoren: Gewahrsein und Spontaneität, während der Therapeut (wie ich im Kapitel über die Gestalt-Techniken zeigen werde) die authentischen Ausdrucksformen anregt und unterstützt und Pathologisches negativ verstärkt („Ego-Reduktion“). Soweit Psychotherapie überhaupt erlernt werden kann, bildet diese Aktivität der Anregung authentischen Verhaltens und des Ansprechens der Fehlfunktionen eine Strategie; soweit Therapie eine Funktion des Grades der Wesensentwicklung des Therapeuten ist, werden beide das spontane Ergebnis ungekünstelter Beziehung und individueller Kreativität sein.
1 Gestalt Therapy Primer: Introductory Readings in Gestalt Therapy, F. Douglas Stephenson, ed. (Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1975)
2 in: Fagan and Shepherd: Gestalt Therapy Now
3 How to Be, Claudio Naranjo, Los Angeles: Jeremy Tarcher, 1991
4 The Handbook of Gestalt Therapy, edited by Chris Hatcher and Philip Himelstein, New Jersey: Jason Aronson, Inc., 1990
5 Das Ich, der Hunger und die Aggression, F. S. Perls
6 „Contributions of Gestalt Therapy“ in: Ways of Growth: Approaches to Expanding Awareness, edited by Herbert Otto and John Mann (New York: Grossman, 1968)
Erster Teil
Innere Haltung und Praxis
der Gestalttherapie
I.
Theorie
KAPITEL 1
Die Bedeutung der inneren Haltung
Die verschiedenen Schulen der Psychoanalyse und insbesondere der Verhaltenstherapie basieren auf der Anwendung bestimmter Ideen und Theorien, die auf der Annahme beruhen, daß psychische Phänomene nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ablaufen. Solche Annahmen führen zu den charakteristischen Verfahren und Techniken der verschiedenen Ansätze. Die Techniken sind der praktische Ausdruck der Ideen, die jene Systeme charakterisieren, und können als die Verhaltensdefinition der jeweiligen psychotherapeutischen Schule betrachtet werden.
Doch sind es überhaupt die Techniken, die zum vermeintlichen Erfolg derjenigen, die sie praktizieren, führen? Wenn die Wirksamkeit einer Psychotherapie vollkommen von der Gesamtheit ihrer Techniken abhängig wäre, könnten wir davon ausgehen, daß eines Tages ein Computer die Funktion des Therapeuten übernehmen kann, und daß sich im Grunde jeder selbst heilen kann, statt sich einem Therapeuten anzuvertrauen, wenn er nur genau weiß, was er zu tun hat. Wir könnten meinen, daß ein Aufzeigen der Selbsthilfetechniken ebenso wirksam wäre wie ein Gespräch von Person zu Person.
Dies ist eine Sichtweise, die heutzutage die meisten Psychologen ablehnen würden, aus der Überzeugung, daß für den Prozeß der Heilung eine persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patient unerläßlich ist. Welcher Art eine solche Beziehung ist, darüber gibt es jedoch noch viel zu sagen, denn die Meinungen von Psychotherapeuten gehen in dieser Hinsicht ebenso weit auseinander wie in ihren theoretischen Ansichten.
Die mittlerweile zu den Klassikern zählenden Studien von Fiedler über das Wesen der therapeutischen Beziehung waren deswegen so wichtig, weil sie gezeigt haben, daß die Experten verschiedener Schulen miteinander mehr gemeinsam haben als mit den weniger erfahrenen Therapeuten der eigenen Schule, sowohl was ihre Vorstellung einer idealen therapeutischen Beziehung als auch was ihr Verhalten während der Sitzungen mit ihren Patienten angeht. Wenn es jedoch darum geht, das Wesen einer solchen erfolgreichen Behandlung zu definieren oder das Ideal zu beschreiben, das von den erfahreneren Therapeuten vertreten wird, sind Fiedlers Informationen unbefriedigend, denn das einzige von ihm klar umrissene Merkmal im Verhalten des Therapeuten ist sein „Verständnis“ für den Patienten. Therapeuten verschiedener Schulen unterschieden sich in Hinblick auf unterstützendes oder tadelndes, direktives oder nondirektives Verhalten sowie die Wahrung der Position der Überlegenheit oder die egalitäre, kooperative Rolle des Therapeuten. Doch alle erfolgreicheren Vertreter dieser Ansätze wurden als verständnisvolle Zuhörer ihrer Patienten gesehen, die sie ausreden ließen, statt ihre Gedankenabläufe zu unterbrechen oder aufgrund eigener persönlicher Bedürfnisse nicht auf sie einzugehen.
Die experimentelle Bestätigung einer Konvergenz der psychotherapeutischen Systeme auf den höheren Verständnisebenen bestätigt nach meiner Überzeugung das, was viele von uns in ihrer Praxis erlebt haben. Darüber hinaus reflektiert es die gegenwärtig wachsende Erkenntnis, daß eine ähnliche Konvergenz „an der Spitze“ zwischen den Wegen der verschiedenen Religionen stattfindet. Wenn der bedeutende Punkt einer solchen Konvergenz und des besprochenen „persönlichen Elements“ nicht in den gedanklichen Formulierungen oder den konkreten Techniken zu finden ist, die die verschiedenen Ansätze unterscheiden, können wir uns fragen, ob sie überhaupt in einer Liste von „Handlungsweisen“ gefunden werden kann, und nicht vielmehr in einer Haltung, einem Zustand, einer typischen geistigen Verfassung, die für solche Verhaltensformen so etwas ist wie eine Gestalt der Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist.
Laura Huxley stellt in ihrem Buch You Are Not The Target (Du bist nicht das Ziel) einen Punkt in den Vordergrund, der für diese Diskussion von großer Bedeutung ist. Immer wieder betont sie im Zusammenhang mit verschiedenen Therapien, daß „sie nur funktionieren, wenn du funktionierst“. Dasselbe könnte man von vielen spirituellen Disziplinen sagen. Trotzdem ist dies möglicherweise die größte Einschränkung einer individuellen Praxis. Selbst beim Erlernen einer Sprache oder eines Musikinstruments bringen nur wenige Menschen die Geduld auf, auch nur die einfachsten und oberflächlichsten Aspekte der betreffenden Fähigkeit ohne fremde Hilfe zu meistern. Wenn es um inneren Wandel geht, wird es ungleich schwieriger, denn wer will sich überhaupt verändern, und wer ist überhaupt in der Lage, wirklich zu „funktionieren“?
Читать дальше