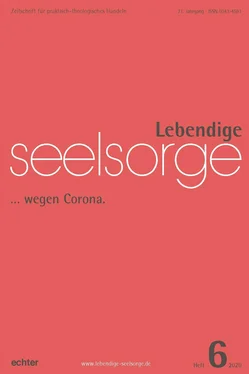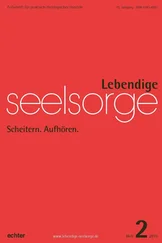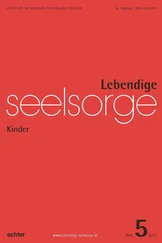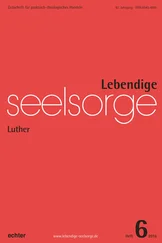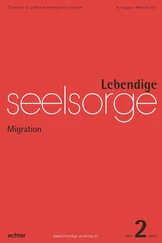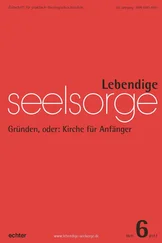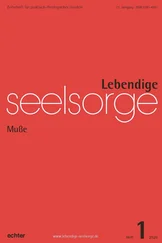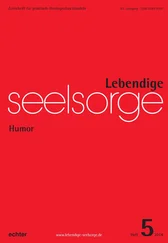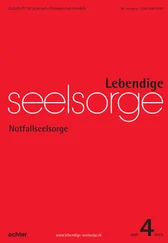Christiane Bundschuh-Schramm
geb. 1963, Dr. theol., Pastoraltheologin, Pastoralreferentin, Diözesanreferentin in der Diözese Rottenburg-Stuttgart; verheiratet, zwei erwachsene Kinder.
Ich meine, dass die klassische Gottesrede von einem allmächtigen, freien, unberührten und ewig unveränderlichen Gott ruinös geworden und für viele nicht mehr glaubhaft ist. Das muss kein endgültiger Beleg sein, dürfte aber doch als Indiz herhalten. Zum einen sind die damit verbundenen Gottesbilder zu männlich, zu herrschaftlich und zu menschlich. Sie sind zu sehr menschlichen Verhältnissen abgeschaut, die in unseren emanzipierten und aufgeklärten Gesellschaften keine Basis mehr besitzen. Wenn es keinen König mehr gibt, der mich regiert, wenn es keinen Vater mehr gibt, der mein Leben bestimmen kann, wenn es keinen Ehemann mehr gibt, der mir bestimmte Rollen aufzwängen kann, warum sollte es den Gott noch geben, der dies nur kopiert hat? Zum anderen erleben die Menschen keinen allmächtigen Gott, der sie befreit oder rettet oder heilt oder erlöst. Norbert Scholl zitiert gängige Kirchenlieder, wie etwa das Lobe den Herren , verweist auf dessen Zeilen wie „der alles so herrlich regieret“ und stellt fest, dass „unser gottesdienstliches Singen und Loben häufig in eklatantem Widerspruch steht zu der uns umgebenden, täglich leidvoll erfahrenen Wirklichkeit“ ( Scholl , 16). Corona hat die gesamte Welt in den Krisenmodus versetzt, da wirken diese Formeln nicht mehr glaubwürdig, auch wenn sie kurz zuvor noch vielen taugten.
BONJOUR UNGEWISSHEIT
Denn kurz zuvor war Moderne. Die säkularen Heilsversprechen funktionierten noch. Es sah so aus, als könnte die gute Zukunft das verlorene zweite Stockwerk ablösen. Freiheit und Gerechtigkeit, Heil und Erlösung waren zu irdisch greifbaren Größen geworden und sind es in der Wohlstandsgesellschaft glücklicherweise für viele immer noch. Zum einen schien das zu Zeiten Jesu ausgebliebene Reich Gottes auf einmal in der Nachkriegsgesellschaft greifbar nah, freilich bis wir merkten, dass die Folgekosten auf der anderen Halbkugel entstehen und die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern immer größer wird. Doch das betraf noch andere in anderen Kontinenten, Corona aber betrifft alle, nicht nur im Blick auf die bleibende Ungewissheit; es ist eine Krise, die auch die Nordhalbkugel nicht verschont. Zum anderen: Es entstand der Eindruck, dass wir das Reich Gottes, wenn es schon damals ausgeblieben ist und in der jenseitigen Zukunft nicht mehr sicher ist – man war schließlich im säkularen Zeitalter angekommen, dass wir es hier auf Erden selber machen können. Die Moderne war ein großartiges Projekt, menschliche Geschichte als Heilsgeschichte zu schreiben, mit Wissen, Wohlstand und Freiheit für alle. Diese modernen Hoffnungen sind als Visionen unhintergehbar, aber sie sind real dennoch brüchig geworden. Der Glaube an das Machbare ist uns abhanden gekommen, denn umso mehr wir Dinge in die Hand nehmen umso mehr scheinen uns andere zu entgleiten: der Wohlstand für alle führt zur Klimakatastrophe, die Reichweitenvergrößerung zum Verstummen der Welt (vgl. Rosa) , die zunehmenden Möglichkeiten führen zur Verknappung von Zeit und zu Unzufriedenheit. In der Moderne konnte die Theologie noch an die säkularen Heilsversprechen anknüpfen, sie konnte die kapitalistischen Wachstumsversprechen auf das Schon und Noch-nicht des Reiches Gottes und den modernen Fortschrittsglauben auf die linear erhofften Befreiungsprozesse von Individuen und ganzen Gesellschaften anwenden. Im II. Vatikanum wurden die religiösen Mittel der Kirche voller Euphorie der Gesellschaft angeboten, um diese nach vorne zu bringen; Zukunft wurde gemacht.
Zurück hieße zurück zu einer überkommenen Theologie, nach vorne hieße möglicherweise zu keiner mehr.
Die Corona-Krise ist hingegen ein Symbol für die grundlegend veränderte Weltsituation. Nicht mehr Wachstum und Fortschritt, Plan und Perfektion kennzeichnen den Weltprozess, sondern Komplexität, Ungewissheit, Kurzfristigkeit und Unsicherheit. Wir befinden uns theologisch in einem Dilemma. Wir können nicht zurück und wir haben den Eindruck, nach vorne können wir auch nicht. Zurück hieße zurück zu einer überkommenen Theologie, nach vorne hieße möglicherweise zu keiner mehr. „Wenn man erst einmal angefangen hat mit dem Fragen, dann kommt man an kein Ende mehr“ ( Scholl , 18), schreibt Norbert Scholl.
Es gibt noch ein weiteres Dilemma für die Gesellschaft und die Theologie, nämlich die Falle der Dystopie. „Die Enttäuschung über den begrenzten Realitätsgehalt des liberalen Fortschrittsideals ist offenbar bei manchen so groß, dass man nun, angetrieben von heftigen Emotionen wie Wut und Trauer, dazu tendiert, ins andere Extrem zu fallen. […] Auf die grenzenlose Euphorie folgt offenbar umstandslos eine Stimmung der tief empfundenen Ausweglosigkeit“ ( Reckwitz , 13). Diese Feldbeschreibung von Andreas Reckwitz hat sich durch die Corona-Krise noch verschärft. Einerseits wäre es fatal, die von Corona herausgeforderte Theologie tappte in die gleiche manisch-depressive Falle, andererseits ist eine redliche Theologie umso dringlicher, die in notwendig permanente gesamtgesellschaftliche Aushandlungsprozesse, „was kulturell als wertvoll zählt und was nicht“ ( Reckwitz , 299) eingespeist werden kann: Was sagen wir als Kirche (in) dieser aus den Fugen geratenen Welt, egal, ob wir Gehör finden oder nicht?
EINE VORSICHTIGE THEOLOGIE
Da es sich abzeichnet, dass auch Weihnachten nicht wie bisher gefeiert werden kann, ist doch nicht die Hauptfrage, in welchem Modus, sprich in welchen Räumen und mit wie vielen Personen gefeiert werden kann. Es geht doch um die viel wichtigere und auch drängendere Frage, was Weihnachten feiern angesichts der Corona-Pandemie und der Klimakatastrophe bedeutet? Was bedeutet es, sich an die Geburt Jesu zu erinnern, wenn sich Eltern fragen müssen, in welche Welt sie ihre Kinder geboren haben? Was heißt es, Jesu Christi Kommen in der Gegenwart zu erwarten, wenn die Klimakatastrophe das fortdauernde Projekt der Inkarnation gefährdet? Was es theologisch bedeutet, wenn jeden Tag 150 Arten der Natur sterben, bringt der Theologe und Zoologe Rainer Hagencord auf den Punkt: „Mit dem Verlust der Arten, mit ihrer Ausrottung, bringen wir Gott zum Schweigen“ ( Hagencord , 4). Was bedeutet Christi Wiederkunft, um den dritten fast vergessenen Topos des Weihnachtsfestes aufzugreifen, wenn die als Heilszeit gedachte Zeit davonläuft, die Wiederkunft sich nur noch im Jenseits ereignen kann?
Es geht um eine vorsichtige Theologie, die dem Fragen mehr Raum gibt und Antworten nicht als Gewissheiten verkauft.
Angesichts dieser Fragen und angesichts beraubter Möglichkeiten in Ewigkeit und Zukunft geht es um ein vorsichtiges Herantasten an den „Gott im Präsenz, im Prozess“ (Faulhaber , 42), um eine Formulierung Kurt Faulhabers aufzugreifen. Es geht um eine vorsichtige Theologie, die dem Fragen mehr Raum gibt und Antworten nicht als Gewissheiten verkauft. Vorsichtig heißt aber nicht weniger Theologie, sondern mehr. Mehr Theologie wagen und fortschreiben ist das Gebot der Corona-Stunde.
GOTT DER LÜCKE
Die Corona-Krise zwingt uns zum social distancing. Und ohne die Krise schönzureden, könnte in dieser Erfahrung eine Spur gelegt sein, die uns zum „Gott der Gegenwart“ führt, wie ihn Ingolf U. Dalferth gegen meinen „Gott von gestern“ behauptet. Interessanterweise hat der Musiker Helge Schneider bei seinen Auftritten die Erfahrung gemacht, dass das Publikum unter Abstandsregeln mehr Nähe verkörpert als der Pulk (vgl. Schneider , 24). Wenn viele Menschen auf einer Fläche mit Abstand stehen, werden die Beziehungen sichtbar und die Wahrnehmung der Personen in den Beziehungen erst dann vollständig möglich. Das entsprechende Bild ist das Netzwerk, in dem die Beziehungen die Knotenpunkte konstituieren und nicht umgekehrt. Durch social distancing entstehen Zwischenräume, die Bezogenheiten sichtbar machen, und die ahnen lassen, dass diese unbegrenzt sind. Ich glaube, eine persönliche Gottesbeziehung geht nicht mehr im Sinne des Ich und mein Herrgott, sondern sie muss genauso unbegrenzt konstituiert werden. Wenn ich mich auf Gott im Hier und Jetzt beziehe, und dies ist meine tägliche Sehnsucht, dann kann ich es nur in einem Allbezug zur Welt, zur leidenden Schöpfung, zu allen Menschen. Henning Luther hat entschieden darauf aufmerksam gemacht, dass sich Sinn und Lebensgewissheit nicht individuell realisieren lassen, sonst verkommt der Glaube zum Heilsegoismus (vgl. Luther ). Noch etwas: Im social distancing muss ich oft einen Schritt zurück machen, um dem Abstandsgebot zu entsprechen. Manchmal muss ich auch zu der Person gegenüber sagen: „Bitte mach einen Schritt zurück.“ Dieser Schritt zurück ist ein Bild für die Gottesbeziehung, für Beziehung überhaupt. Nur im Schritt zurück, im Freilassen und Raumgeben entsteht eine Ahnung für die Größe des anderen, für den Zwischenraum, in dem Gott verborgen weilt. Ich glaube nicht, dass wir „auf Gott draufsitzen“, wie Ingolf U. Dalferth meint, wenn er schreibt: „Gott ist uns so nahe, dass es keine Distanz zu ihm gibt. Ohne Distanz aber können wir nichts wahrnehmen“ ( Dalferth , 31). Ich glaube eher, dass es im Glauben um eine neue Sensibilität für die Möglichkeitsräume dazwischen geht, um die Chance, dass sich zwischen Menschen etwas ereignet, was göttliche Spuren beinhaltet. Ein kürzlicher Besuch in der Kunststation St. Peter, Köln hat mir dies erneut anhand des Altars von Eduardo Chillida vor Augen geführt. Dieser Altar besteht aus drei Teilen, die so angeordnet sind, dass zwischen Zelebrant*in und Altar bzw. allem, was auf diesen gestellt wird, ein Zwischenraum entsteht, eine Lücke, die im Handling der Gaben überwunden wird und gleichzeitig unüberwindbar bleibt. Sprechender kann Kunst kaum sein und sprechend ist auch die immer noch ärgerliche Tatsache, dass dieses Kunstwerk in das linke Seitenschiff verbannt wurde, als ob die Kirche diese Lücke schließen könnte und nicht offenhalten müsste. Ich meine, unter Corona-Bedingungen ist Gott eher die Lücke, die offen bleibt, als der/die, der/die die Lücken schließt.
Читать дальше