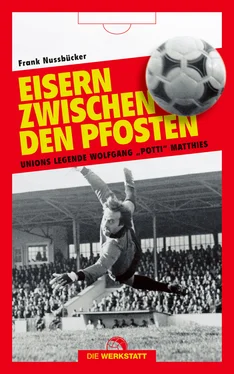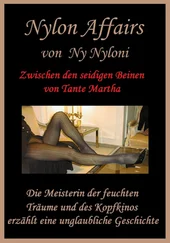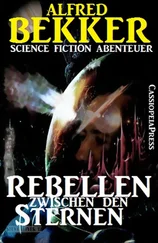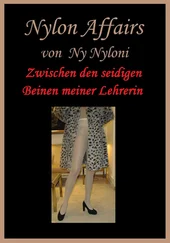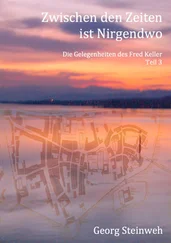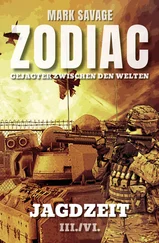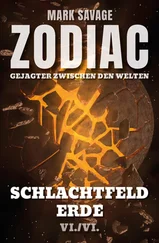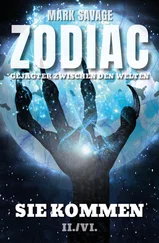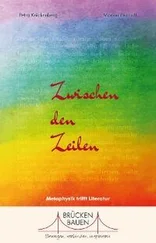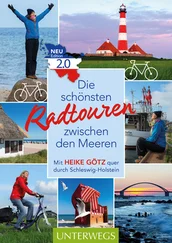5Bei der besagten Partie handelte es sich höchstwahrscheinlich um den 3:1-Heimsieg von Union gegen Stendal am 13. Mai 1967, dem 26. und finalen Spieltag der DDR-Oberliga. Hier standen laut Statistik von sport.de sowohl Sigusch wie auch Wruck auf dem Rasen.
6Die Abkürzung BA steht für „Bekleidung und Ausrüstung“. In besagter Kammer lagerte alles, was Armeeangehörigen bei der Einkleidung ausgehändigt wurde.
7Gemeint sind die beiden berühmten Union-Spieler Günter „Jimmy“ Hoge und Wolfgang „Ate“ Wruck. Während Sigusch Ersteren nur noch im Training kennenlernte, bestritt er mit Wruck über mehrere Jahre etliche Spiele, ehe „Ate“ nach der Saison 1973/74 zur BSG Bergmann-Borsig Berlin wechselte.
8Helmuth Hellge war ab 1966 förderndes Mitglied bei Union. Neben vielen anderen ehrenamtlichen Aktivitäten im und für den Verein machte er sich vor allem als Mitgestalter des seit 1967 erscheinenden Journals Union-Informationen verdient, wo er unter der Leitung von Bernhard Braunert mit Dieter Hobeck, Klaus-Jürgen Hoffmann sowie Horst Schrader zusammenarbeitete. Anfang der 2000er aus Altersgründen ausgetreten, wurde Hellge 2016 zum zweiten Mal offizielles Vereinsmitglied des 1. FC Union Berlin – mit 94 Jahren!
SEIT 50 JAHREN EINE CLIQUE
Wolfgang Matthies, Joachim Sigusch und Rolf Weber bilden mittlerweile seit fast fünf Jahrzehnten eine Clique, wie Weber 2017 herausstellt: „Wir kennen uns seit 1972, auch unsere Frauen treffen sich seither regelmäßig. Wir wohnten ja eine Weile alle in einer Ecke, in der Nähe vom Ostbahnhof, wo viele Unioner wohnten. Potti und ich in der Singerstraße, Bulle etwa fünf Minuten zu Fuß von uns entfernt.“
Alle drei Spieler zusammen bringen es auf insgesamt 795 Pflichtspieleinsätze für den 1. FC Union Berlin. Doch sie trainierten und spielten nicht nur zusammen, wie Potti erzählt: „Wenn wir mit dem Bus vom Auswärtsspiel zurückkamen, zogen wir nach einem Sieg erst mal in ‘ne Gaststätte ein. Das passierte allerdings nicht allzu oft.“
Dennoch häufig genug zum Leidwesen der Frauen, wie Wolfgang Matthies‘ Gemahlin 2020 bemerkt. Rolf Weber weiß das Ganze allerdings ein wenig zu relativieren: „Wir wussten ja, die Frauen treffen sich auch. Die saßen zu Hause zusammen, und wir gingen in die Kneipe.“ – „Und Uli Werder musste unsere Taschen nach Hause bringen!“, behält Matthies einmal mehr das letzte Wort.
Ulrich Werder hatte aber nicht etwa unfreiwillig als Wasserträger herzuhalten, wie mir Potti sofort versichert: „Der wollte nicht mit uns in die Gaststätte, sondern nach Hause. Also hat er unsere Taschen mitgenommen, aus Sympathie“, setzt er lachend hinzu. Genau wie Weber, Matthies und Sigusch wohnte nämlich auch Ulrich Werder einige Zeit am Ostbahnhof. Wenn nun die drei Herren direkt nach dem Ausstieg Richtung Gaststätte aufbrachen, übernahm ihr freundlicher Mitspieler ihre Sporttaschen, um sie, quasi vis-à-vis seiner eigenen Bleibe, bei deren Frauen abzuliefern.
Rolf Weber wird fast ein bisschen wehmütig, als er hinzufügt: „Das sind so Sachen, die jetzt überhaupt nicht mehr möglich wären. Stiegen heutzutage sechs, sieben Erst- oder Zweitliga-Spieler aus Flieger oder Mannschaftsbus und spazieren erst mal in ‘ne Kneipe, kämen sofort unzählige Blitzlichter zum Einsatz.“
Davon abgesehen, dass es anschließend einen moralischen Aufschrei sämtlicher Boulevardmedien gäbe. In den 1970er Jahren beim 1. FC Union Berlin lief dieses Prozedere ohne jedwede Erwähnung in der Presse ab, wie Matthies, Sigusch und Weber zu erzählen wissen: „Montag war so eine Art Regenerationstag, mit Sauna und ein bisschen Abtrainieren. Danach rückten wir zu zehnt in den Sandmann oder am Alex ins Bowling-Center ein. Später besuchten wir auch die Gutenberg-Stuben am Ostbahnhof. Das sind Sachen, an die erinnern wir uns noch immer gerne“, bekennt Weber 2017. „Das können die Berufsfußballer heute gar nicht mehr! Die kriegen zwar alle einen Haufen Geld, aber die müssen sich ja so disziplinieren. Heutzutage würde die BILD -Zeitung wer weiß was draus machen. Aber nicht, dass du denkst, unsere Truppe hätte nur gesoffen!“, ermahnt er mich und fährt fort: „Kam der eine oder andere mal spät von einer Geburtstagsfeier zurück, stand er morgens eben ein bisschen müde da. Aber das wurde nicht überbewertet. Seine Leistung brachte er ja trotzdem.“ Wenngleich ihr langjähriger Trainer Heinz Werner wohl nie verstehen konnte, dass ein Fußballspieler am Abend mehrere Bier hintereinander trank oder obendrein gar noch rauchte – zu beiden Themen gleich mehr.
Apropos Geburtstagsfeiern: Wolfgang Matthies litt zu keiner Zeit unter Berührungsängsten mit Union-Fans. „Es gab bei Union zwee Zwillings-Mädels, die ihren 18. Geburtstag feiern wollten“, erinnert er sich 2017. „Sie fragten mich, ob ich zu ihrer Geburtstagsparty komme. Wahrscheinlich rechneten sie nicht mit meinem Erscheinen. Als ich dann tatsächlich bei ihnen auf der Matte stand, waren sie völlig von den Socken. Ich war ja nicht so viel älter als sie, vielleicht grad mal zwanzig oder so. Für die beiden war ick der große Held bei Union, und dass der zu ihrem 18. Geburtstag antanzte, davon reden sie glaube ich heute noch.“ Und wie sie das tun, selbstverständlich auch in diesem Buch!
Generell fühlten sich die Union-Spieler jener Jahre nicht als Stars. Natürlich war ihnen klar, dass sie etwas mehr unter allgemeiner Beobachtung standen als manch anderer Mitbürger. Berührungsängste mit den Fans waren ihnen indes fremd. „Das gab‘s bei uns noch nicht“, stellt Kapitän Sigusch klar, „anderenfalls wären wir doch nicht einfach so zum Sandmann in die Kneipe gegangen, wo uns jeder kannte.“
„So bewusst war uns das nicht, dass wir eine besondere Stellung innehatten“, bestätigt Matthies, wobei er hinzusetzt: „Zumindest dachte ich manchmal so bei mir: Andere gehen für 500 Mark im Monat arbeiten, und du kriegst ja schon ein bisschen mehr. Vielleicht haben wir uns doch ab und zu als ein bisschen ,was Besseres‘ gefühlt? Ich weiß es nicht.“
Im Stadion jedenfalls gaben die Union-Spieler jederzeit gern Autogramme, sobald sie jemand danach fragte. Aus Matthies‘ Mund heißt das: „Wenn eener kam, haben wir nie gesagt: ,Lass mich in Ruhe‘, und schickten ihn weg.“
Genau wie heute standen beim Training immer ein paar Leute an der Barriere, die aufmerksam begutachteten, was „ihre“ Spieler da auf dem Rasen so anstellten. Und selbstverständlich wussten auch die „Kiebitze“ von damals ganz genau, wo und wie der Hase läuft.
Während des Spiels und danach zeigten sich die Unioner auf den Stadionstufen durchaus kritisch gegenüber ihren Spielern. Obgleich auch schon damals das Auspfeifen der eigenen Mannschaft verpönt war, kam es durchaus vor, dass Fans diesen oder jenen Spieler ins Visier nahmen, wenn der mal nicht so beherzt gespielt hatte, wie sie das von ihm erwarteten. Dazu Sigusch: „Das waren paar Sachen, die dann für den Betreffenden nicht so angenehm waren.“
Der Zorn der Unioner von den Rängen konnte durchaus auch mal der gesamten Mannschaft gelten, wie Rolf Weber weiß: „Unter Dieter Fietz verloren wir in der katastrophalen Aufstiegsrunde 1974/75 zu Hause 1:5 gegen Energie Cottbus. Wir zogen uns damals in so ‘ner Baracke um, und nach dem Spiel wollten etwa vierzig Unioner diese Baracke stürmen. Uns war klar, dass die uns nicht an die Gurgel wollten, die Belagerung fühlte sich trotzdem ganz schön bedrohlich an.“
Am Ende wurde niemand verletzt, und alle Spieler kamen unversehrt nach Hause – ohne Einsatz von Polizei, Ordnungsdienst oder anderen Sicherheitskräften. Webers Fazit: „Emotionen sowohl in die eine wie in die andere Richtung gab‘s auch damals, aber vom Prinzip her herrschte immer der Grundsatz: Ein Unioner wird nicht beschimpft, der wird auch nicht ausgepfiffen, ditt is‘n Unioner!“
Читать дальше