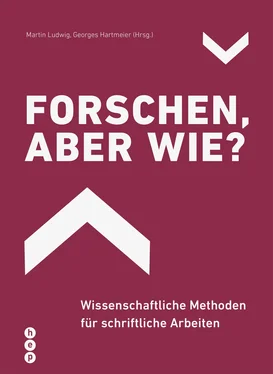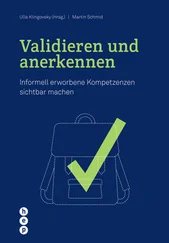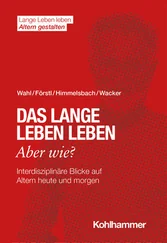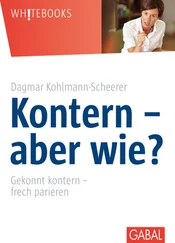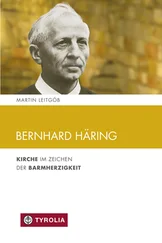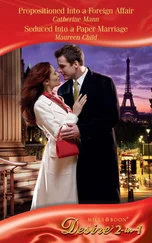Welche der folgenden Daten weisen einen klaren Raumbezug auf?
• Benzinpreis an verschiedenen Tankstellen im Grossraum Bern an einem bestimmten Stichtag
• Notendurchschnitt im Fach Mathematik in den Klassen in Ihrem Schulhaus
• Anbauprodukte auf den verschiedenen Parzellen eines Bauernbetriebs
• Lohnstruktur bei den SBB
• Herkunft der Gemüseverkäuferinnen und -verkäufer auf dem Wochenmarkt
• Schüttmengen (Wasseraustritt in Litern pro Minute) und Wasserqualität natürlicher Quellen im Kanton Glarus
• Beschlagnahmtes Kokain am Flughafen Zürich
• Verkehrsaufkommen in der Länggasse (Berner Stadtquartier)
Viele Fragestellungen, die sich aus den sozial-, wirtschafts- oder naturwissenschaftlichen Themen von Maturaarbeiten ergeben, führen zu ortsgebundenen Daten, lassen sich also kartografisch darstellen. Warum also nicht selbst eine Karte anfertigen, um die gesammelten Informationen in ihrer räumlichen Verbreitung festzuhalten, darzustellen und auszuwerten?
Man unterscheidet Karten und Pläne, die auf Sekundärdaten (zum Beispiel aus Publikationen, von Amtsstellen oder aus dem Internet) basieren, und Karten, auf denen Daten festgehalten werden, die aus eigenen Erhebungen (Zählungen, Beobachtungen, Befragungen, Messungen) stammen, also aus Primärdaten.
Wenn Sie Sekundärdaten auswerten, müssen Sie die zu untersuchenden Grössen (zum Beispiel Höhe der Wohnungsmieten, Steuerbelastung, Niederschlagsmengen, Mass der eingestrahlten Sonnenenergie oder Ähnliches) einzelnen Raumpunkten zuordnen und auf einer Karte oder einem Plan darstellen. Für diese Arbeit ist es nicht nötig, diese Orte im Raum aufzusuchen. Allerdings müssen die Daten so erfasst worden sein, dass eine räumliche Zuordnung möglich ist (zum Beispiel Hausnummern oder GPS-Koordinaten).
Das Sammeln von Primärdaten hingegen setzt oft Recherchen vor Ort, das heisst direkt beim zu untersuchenden Objekt, voraus. Die Arbeit vor Ort ist anspruchsvoll, unterscheidet sich aber wohltuend vom Unterricht im Klassenzimmer, indem Sie sich einmal mit dem «wirklichen Leben» auseinandersetzen können anstatt nur mit Informationen aus Lehrbüchern, Statistiken oder Filmen.

Aufgabe 2 Recherchen vor Ort
Bei welchen der folgenden möglichen Arbeitsthemen sind Recherchen vor Ort sinnvoll oder sogar notwendig? Die Lösungsvorschläge ergeben viele Hinweise auf die Rahmenbedingungen der diskutierten Themen.
• Die Regulierung des Hirschbestands im Schweizerischen Nationalpark
• Nutzung der öffentlichen Plätze in der Stadt Basel
• Die Herrschaft von Louis XIV
• Berglandwirtschaft in Grindelwald. Krisen und Chancen
• Das Autobahnkreuz Härkingen/Egerkingen als Lebens- und Wirtschaftsraum
• Schulstress. Wie gehe ich mit Prüfungsangst um?
• Einkaufsmöglichkeiten und Einkaufsverhalten in Beinwil am See
• Ölmalerei und Aquarellieren – Zwei Maltechniken im Vergleich
Recherchieren vor Ort, Daten erheben im Gelände und die kartografische Darstellung der Ergebnisse gehen oft Hand in Hand. Im nächsten Abschnitt lernen Sie einerseits, was alles zur Planung, Vorbereitung und Durchführung einer Messkampagne im Feld gehört, andererseits, worauf Sie bei der Wahl der Untersuchungsstandorte und bei der kartografischen Darstellung der Ergebnisse achten müssen.
3.2 Planen der Geländearbeit
Geländearbeit ist erfahrungsgemäss mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie sorgfältige und umfassende Vorbereitungen treffen. Sie müssen sich gut überlegen, welche Daten Sie zu welchem Zweck im Gelände erfassen wollen. Die zu erhebenden Daten sind selbstverständlich von Ihrer Fragestellung abhängig. Die folgenden beiden Beispiele sollen Ihnen zeigen, welche Überlegungen Sie vor der Erhebung der Daten im Gelände machen müssen.
Sie möchten herausfinden, wie sich ein Quartier in Ihrer Stadt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert hat. Interessiert Sie vor allem die bauliche Entwicklung (alter Baubestand, Zustand der Häuser, Renovationen, Neubauten)? Oder möchten Sie herausfinden, wie die Gebäude früher und heute genutzt wurden (Wohnen, Restaurant, Gewerbe, Einkaufen)? Vielleicht interessieren Sie sich eher für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers (Familiengrössen, Altersstruktur, soziale Schicht, Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld und der Infrastruktur)? Oder sogar für alle diese Aspekte?

Abbildung 3.1:Wer wohnt in diesen Häusern in der Lorraine? Wann sind die Häuser gebaut worden, welche Veränderungen haben sie seither erfahren (siehe Abbildung 3.11)?
Aus den abgeleiteten Fragestellungen und Arbeitshypothesen ergeben sich einerseits die Merkmale (Variablen) und deren Ausprägungen (siehe Abschnitt 6.1), die Sie vor Ort erfassen müssen, andererseits die Methoden, mit deren Hilfe Sie die Informationen gewinnen wollen. Machen Sie Beobachtungen, Umfragen oder Zählungen auf der Strasse oder vielleicht Messungen (zum Beispiel zum Lärmpegel)? In jedem Fall lassen sich die erhobenen Daten auf einer Karte oder einem Plan darstellen, und die räumliche Verteilung der Merkmale lässt sich so veranschaulichen.
Ein anderer Untersuchungsraum findet sich im Hochgebirge: Die Gletscher schmelzen und geben ein Gebiet frei, das unter Umständen während mehrerer Jahrhunderte bis Jahrtausende von Eis bedeckt war. Nun möchten Sie herausfinden, wie sich die Vegetation in diesem Gletschervorfeld entwickelt hat. Sie könnten zum Beispiel den Bedeckungsgrad (Prozentanteil des Bodens, der von Vegetation bedeckt ist) abschätzen. Oder Sie könnten versuchen, auf einer bestimmten Fläche die Pflanzen zu zählen und deren Arten zu bestimmen. Oder Sie machen am besten beides. Aus diesen Beobachtungen und Zählungen könnten Sie dann Rückschlüsse auf die Wiederbesiedlung des Gletschervorfelds mit Vegetation – die sogenannte Sukzession – ziehen.

Abbildung 3.2:Das Abschmelzen des Steingletschers legt Moränenwälle und das Gletschervorfeld frei. Wie entwickelt sich die Vegetation auf diesen Flächen?
Wie Sie sicher beim Lesen der Beispiele schon festgestellt haben, braucht es – unabhängig von der genauen Fragestellung und vom konkreten Untersuchungsraum – gute Kenntnisse über die Gegebenheiten im Gelände. Ein wichtiger Schritt bei der Planung einer Datenerhebung im Gelände ist daher immer eine Ortsbegehung . Suchen Sie Ihren geplanten Untersuchungsraum auf, machen Sie sich ein Bild der Verhältnisse vor Ort, überprüfen Sie die Zugänglichkeit: Ist der Innenhof auch für Nicht-Hausbewohnerinnen und Nicht-Hausbewohner offen? Kann ich den Fluss im Gletschervorfeld ohne grossen Umweg überqueren? Halten Sie Ausschau nach günstigen Standorten für Befragungen, Beobachtungen oder Messungen. Tools wie zum Beispiel «Google Street View» sind zwar gute Planungshilfen, ersetzen aber den persönlichen Besuch im Untersuchungsraum nicht.
Das weitere Vorgehen lässt sich in folgende Schritte gliedern:
• Beschaffen einer Grundlagenkarte: Da Sie sich ja im Gelände zurechtfinden und bestimmte Stellen für die Datenerhebung aufsuchen müssen, brauchen Sie eine Karte oder einen Plan Ihres Untersuchungsraums.
Читать дальше