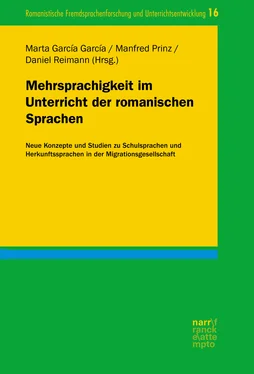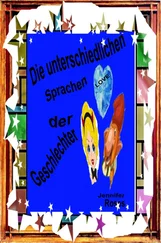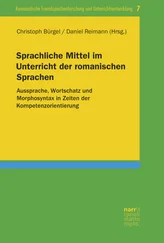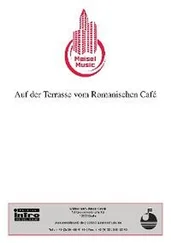Kramsch, Claire. 2011. „Symbolische Kompetenz durch literarische Texte“, in: Fremdsprache Deutsch , 44, 35-40.
Krumm, Hans-Jürgen. 2001. Kinder und ihre Sprachen – lebendige Mehrsprachigkeit . Wien: Eviva.
Krumm, Hans-Jürgen. 2008. „Plurilinguisme et subjectivité: ‚Portraits de langues’ par les enfants plurilingues”, in: Zarate, Geneviève / Lévy, Danielle / Kramsch, Claire (ed.) : Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Paris: éditions des archives contemporaines, 109-112.
Larsen-Freeman, Diane. 1997. „Chaos/complexity science and second language acquisition“, in: Applied Linguistics 18, 2, 141–65.
Mardt, Selina. 2018. Unterrichtliche Interaktionsmuster als bedingender Faktor für Ausprägungen von Mehrsprachigkeit. Eine qualitative Untersuchung von Französischunterricht mithilfe der Grounded-Theory-Methodologie. Göttingen: unveröffentlichtes Manuskript (Masterarbeit).
Meißner, Franz-Joseph. 2001. „Aus der Mehrsprachigkeitswerkstatt“, in: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, 1, 30-35.
Nicolas, Laura. 2012. „L’apprenant-médiateur: enjeux et perspectives des traductions spontanées en classe de FLE“, in: Etudes de linguistique appliquée, 167, 369-380.
Plikat, Jochen. 2017. Fremdsprachliche Diskursbewusstheit als Zielkonstrukt des Fremdsprachenunterrichts. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Interkulturellen Kompetenz. Frankfurt et al.: Peter Lang.
Reimann, Daniel. 2016. „Aufgeklärte Mehrsprachigkeit – Sieben Forschungs- und Handlungsfelder zur (Re-)Modellierung der Mehrsprachigkeitsdidaktik“, in: Rückl, Michaela (ed.): Sprachen & Kulturen vermitteln und vernetzen . Münster / New York: Waxmann, 15-33.
Reimann, Daniel / Rössler, Andrea. (ed.). 2013. Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht . Tübingen: Narr.
Rückl, Michaela. 2015. „Spanisch interlingual lernen. Anregungen für die Unterrichtspraxis“, in: Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, 51, 44-49.
Rückl, Michaela / Holzinger, Gabriele / Pruniaux, Flavie / Guicheney, Gaelle / Brandner, Irene. 2013. Découvrons le français. Französisch interlingual. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky.
Schädlich, Birgit. 2012. „La mise en oeuvre de la médiation linguistique dans les langues vivantes en Allemagne: instructions officielles, manuels, pratiques de classe”, in: Etudes de linguistique appliquée, 167, 325-339.
Schädlich, Birgit. 2013. „Ansätze zu einer Didaktik der Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität im Unterricht der romanischen Sprachen“, in: Zeitschrift für romanische Sprachen und ihre Didaktik 7, 2, 25-46.
Schädlich, Birgit. 2016. „Médiation linguistique et didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme“, in: Medhat-Lecocq, Héba / Negga, Delombera / Szende, Thomas (ed.): Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation. Paris: éditions des archives contemporaines, 81-89.
Schmelter, Lars. 2012. „Sprachbewusstheit – mehr als Grammatik“, in: Burwitz-Melzer, Eva / Königs, Frank G. / Krumm, Hans-Jürgen (ed.): Sprachenbewusstheit im Fremdsprachenunterricht . Tübingen: Narr, 189-197.
Schmenk, Barbara. 2012. „Globalisierung und Sloganisierung zentraler Begriffe der Fremdsprachenforschung“, in: Bär, Marcus (ed.): Globalisierung – Migration – Fremdsprachenunterricht: Dokumentation zum 24. Kongress für Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF), Hamburg, 28. September – 1. Oktober 2011. Hohengehren: Schneider, 413–415.
Seedhouse, Paul. 2004. The Interactional Architecture of the Language Classroom: A Conversation Analysis Perspective . Malden, MA: Blackwell.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland 2004. Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 4. 12. 2003 . München: Luchterhand. Online: www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland. 2012. Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss vom 18.10.2012). Online: www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf
Strauss, Anselm / Corbin, Juliet. 1996. Grounded Theory. Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz.
Surkamp, Carola (ed.). 2017. Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik , 2. Auflage. Stuttgart: Metzler.
Titone, Renzo. 2004. „ History: The nineteenth century “, in: Michael Byram (ed.), Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning , London / New York, Routledge, 264-270.
Van Lier, Leo. 2004 . The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Perspective . Norwell: Kluwer Academic Publishers.
Wandruszka, Mario. 1979. Die Mehrsprachigkeit des Menschen. München: Piper&Co.
Zarate, Geneviève / Lévy, Danielle / Kramsch, Claire (ed.). 2008. Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme . Paris: éditions des archives contemporaines.
Ziegler, Gudrun / Sert, Olcay / Durus, Natalia. 2012. „Student-initiated use of multilingual resources in English-language classroom interaction: next-turn management“, in: Classroom discourse, 3, 2, 187-204.
Der Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (REPA) – Beispiele zum Einsatz und Nutzen der Deskriptoren
Anna Schröder-Sura
Seit dem Erscheinen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lehren, lernen, bewerten (fortan GeR) (Europarat 2001) ist der Einsatz von Referenzrahmen und ihren Deskriptoren im Kontext von Sprachunterricht kaum noch wegzudenken. Die Grenzen des GeR und von Referenzrahmen allgemein sind ausführlich diskutiert worden (z.B. Barkowski; Christ; Quetz in Bausch et al. 2003; Harsch 2007; North 2014, 22ff). Auch bergen sie, wie jede Form von Standardisierung, „die Gefahr, individuelle Sprachenprofile und kreativ-ästhetische Inhalte […] zu verhindern“ (Krumm 2016, 47) bzw. stark zu vernachlässigen.
Die Vorteile für das Sprachenlernen und -lehren liegen mit Begriffen wie Kohärenz, Transparenz, Vergleichbarkeit, Förderung möglicher Kooperationen sowie Perspektive auf lebenslanges Lernen, um nur eine Auswahl zu treffen, ebenfalls auf der Hand (Europarat 2001, 18f). Im GeR werden die Kompetenzbereiche dargestellt und entsprechende detaillierte Niveauskalen für die kommunikativen Kompetenzen in den Fokus genommen. Dadurch kann er laut Coste (2017, 17) als ein Vektor der „Kontinuität“ in der Fremdsprachendidaktik betrachtet werden.
Auch die mehrsprachige und plurikulturelle Kompetenz hat dank dieses Dokuments eine hohe Verbreitung erfahren. Insgesamt spielt sie jedoch eine untergeordnete Rolle (Castellotti 2017, 66). Bei der Beschreibung der Kompetenzen wird den mehrsprachigen Repertoires der Lernenden wenig Beachtung geschenkt und das Können in den Zielsprachen wird in den KANN-Beschreibungen „in ganz traditioneller Weise“ (vgl. Christ 2003, 65) abgebildet (vgl. Morkötter / Schröder-Sura 2018, 232). Kritisch betrachtet hat der GeR ein vereinfachtes und reduziertes Konzept der mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenz propagiert, in dem das (eher isolierte) Erlernen mehrerer Sprachen im Vordergrund steht, doch das Potential mehrsprachiger Lernerprofile sowie die vielfältigen Aneignungswege unberücksichtigt bleiben (vgl. Castellotti 2017, 63ff)1. Für Coste (2017, 17) gehört das Aufgeben einer curricularen Trennung von Sprachen jedoch zu den notwendigen „Brüchen“, die zu einer Entwicklung der Fremdsprachendidaktik beitragen können. Durch die fehlende Konkretisierung einer entsprechenden mehrsprachigkeitsdidaktischen Umsetzung bewegt sich dieser Bruch im GeR lediglich auf der deklarativen Ebene.
Читать дальше