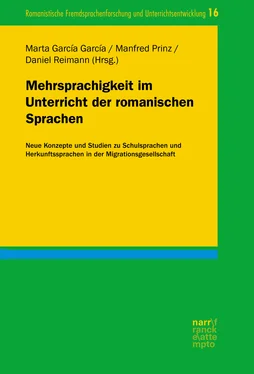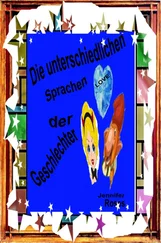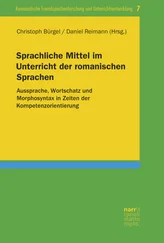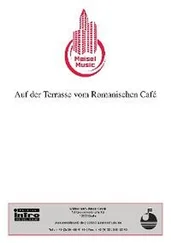Clémentine Abel / Katja F. Cantone / Marta García García / Lilli Papaloïzos / Carine Greminger Schibli / Jacqueline Gutjahr / Andrea Bogner / Daniel Reimann / Christian Koch / Amina Kropp / Giuseppe Manno / Mirjam Egli Cuenat / Manfred F. Prinz / Giulia Pelillo-Hestermeyer / Ute von Kahlden / Daniel Reimann / Birgit Schädlich / Anna Schröder-Sura / Katharina Wesselmann
Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen
Neue Konzepte und Studien zu Schulsprachen und Herkunftssprachen in der Migrationsgesellschaft
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
[bad img format]
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.narr.de• info@narr.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8385-7 (Print)
ISBN 978-3-8233-0204-9 (ePub)
Einleitung
Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen – Forschungsstand und neue Konzepte zur Vernetzung von Schulsprachen und Herkunftssprachen in der Migrationsgesellschaft
Marta García García / Daniel Reimann
Mehrsprachigkeit ist seit Jahrzehnten eines der zentralen sprachen- und bildungspolitischen Anliegen der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union, Mehrsprachigkeitsdidaktik seit nunmehr beinahe drei Jahrzehnten eines der zentralen Forschungsfelder der deutschsprachigen Fremdsprachendidaktik (einführend z.B. Reimann 2018, bes. 29, 39-46). Der romanistischen Fremdsprachendidaktik kam bei der Entwicklung mehrsprachigkeitsdidaktischer Ansätze bezogen auf schulischen Fremdsprachenunterricht insofern eine Vorreiterrolle zu, als die romanischen Sprachen – von wenigen Ausnahmen im Bereich der slavischen Sprachen sowie den nicht unmittelbar vergleichbaren Konstellationen des Niederländisch- und Dänischunterrichts abgesehen – die einzige Sprachenfamilie darstellen, aus der regelmäßig mehr als eine Fremdsprache im Laufe einer Schullaufbahn erlernt werden kann (z.B. Französisch als zweite und Italienisch oder Spanisch als dritte Fremdsprache) (vgl. Reimann i.Vb.).
Zugleich wird landläufig festgestellt, dass die Anliegen der Mehrsprachigkeitsdidaktik noch immer zu wenig Eingang in die (Schul-)Praxis gefunden haben. Allerdings wird sich Schule in zunehmendem Maße auch an der Umsetzung mehrsprachigkeitsdidaktischer Ansätze messen lassen müssen, nicht zuletzt, seit durch Aufnahme der Bereiche Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz in die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (KMK 2012, 11, 23sqq.) grundlegende Bausteine der Mehrsprachigkeitsdidaktik zu Kompetenzzielen des Fremdsprachenunterrichts in der Oberstufe erhoben wurden (zur Verbindung der Konzepte vgl. Morkötter 2005).
In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Veränderungen in der Schüler- (und Lehrer-)schaft ergeben, aufgrund derer Mehrsprachigkeitsdidaktik „neu gedacht“, d.h. theoretisch und konzeptionell weiterentwickelt, weiter beforscht und unterrichtspraktisch ausgestaltet werden muss. Insbesondere ist hier auch die sprachliche Heterogenität der Schülerschaft – wie auch, in zunehmendem Maße, der Lehrerschaft – zu nennen, welche die Lernvoraussetzungen im Fremdsprachenunterricht mitbedingt (z.B. Hu 2003, Volgger 2012) und in der Lehrerausbildung mit berücksichtigt werden muss (vgl. z.B. Benholz et al. 2017, Reimann et al. 2018, Strobl et al. 2019, Reimann / Cantone im Druck). Mehrsprachigkeitsdidaktik kann sich also nicht mehr nur auf Vernetzung von Schulfremdsprachen untereinander beziehen, sondern muss die Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler miteinbeziehen (z.B. Schmelter 2015). Eine besondere Konstellation besteht, wenn als Fremdsprache eine Herkunftssprache gewählt wird (vulgo: „Muttersprachler/innen“ im Fremdsprachenunterricht, vgl. die Beiträge Cantone und Reimann im vorliegenden Band).
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, einen Überblick über die neuere Geschichte der Mehrsprachigkeitsdidaktik aus romanistischer Perspektive zu geben, in deren Rahmen die Beiträge des vorliegenden Bandes zu verorten sind (zur Vorgeschichte einführend Reimann 2018, 45sq., mit weiterführender Bibliographie): Insgesamt hat sich die jüngere Mehrsprachigkeitsdidaktik im weiteren Sinne im deutschsprachigen Raum seit den 1990er Jahren intensiv entwickelt. Ausgehend von vereinzelten Vorläufern wie beispielsweise den Beiträgen Abel 1971, Barrera-Vidal 1972, Oehler 1972, Ernst 1975 und Zapp 1979 sowie 1983 zeichnet sich in den 1980er Jahren ein verstärktes Interesse für Spezifika des Lernens und Lehrens dritter und spät beginnender Fremdsprachen ab (z.B. Christ 1985), das im sog. Bochumer Tertiärsprachenprojekt, in dem Spezifika des Italienisch- und Spanischunterrichts zu ergründen versucht werden, kulminiert (vgl. die zusammenfassende Ergebnisdarstellung in Bahr et al. 1991).
In den 1990er Jahren legen insbesondere Franz-Joseph Meißner und Marcus Reinfried die Grundlagen für die Entwicklung einer „Didaktik der romanischen Mehrsprachigkeit“ (vgl. z.B. Meißner 1991 und 1993, Meißner / Reinfried 1998, weiterhin z.B. Martinez / Reinfried 2006). Weitere Veröffentlichungen reflektieren Potentiale und Erträge der Mehrsprachigkeitsdidaktik aus schulpraktischer Sicht und mit Blick auf die Lehrerbildung (z.B. Hildenbrand / Martin / Vences 2012). Parallel entwickelt sich im Kontext der Didaktik des Deutschen als Fremdsprache die so genannte „Tertiärsprachendidaktik“ weiter, die insbesondere die Sprachenfolge „Deutsch nach Englisch“ und ihre didaktisch-methodischen Implikationen untersucht (z.B. Hufeisen 1991, Hufeisen / Lindemann 1998).
In den späten 1990er und in den 2000er Jahren konzentriert sich die Forschung insbesondere auf den Bereich der Interkomprehension (vgl. z.B. Meißner 2005), also die Entwicklung rezeptiver Kompetenzen (v.a. Leseverstehen) auf der Grundlage umfassenderer Kompetenzen in anderen (hier v.a. romanischen) Sprachen. Ausgangs- und Referenzpunkt ist das Frankfurter Projekt EuroCom (vgl. Klein / Stegmann 2000), das entsprechende Pendants in romanophonen Kontexten kennt (z.B. Galatea, Galanet, EuRom 4 / EuRom 5, Interlat, InterRom, für eine Übersicht vgl. Caddéo / Jamet 2013, bes. 141-181, vgl. exemplarisch Bonvino 2011) und trotz seiner hochschuldidaktischen Konzeption auch in den schulischen Bereich zu transferieren versucht wurde (z.B. Klein 2004). Es entstanden in der deutschsprachigen Fremdsprachenforschung mehrere umfassende empirische romanistisch-interkomprehensionsdidaktische Studien (z.B. Bär 2009, Mordellet-Roggenbuck 2011). Zugleich gab es, ausgehend von EuroCom, entsprechende Parallelprojekte im Bereich der germanischen und der slavischen Sprachen. Mitunter wird auch – über die o.g. interkomprehensionsdidaktischen Arbeiten im engeren Sinne hinaus – die Perspektive von Schülerinnen und Schülern empirisch erfasst (z.B. Reimann 2002, Neveling 2017).
Seit den 2010er Jahren zeichnet sich eine zunehmende Öffnung der traditionellen romanistischen Mehrsprachigkeitsdidaktik hin auch zum Englischen ab (z.B. Leitzke-Ungerer / Blell / Vences 2012, Bär 2012, Schöpp 2015, zahlreiche Beiträge von Eva Leitzke-Ungerer, z.B. Leitzke-Ungerer 2015). Der Englischunterricht nimmt seinerseits seine Verantwortung als inzwischen überwiegend erste Fremdsprache, die Zugänge zum Erlernen weiterer Fremdsprachen eröffnen kann und soll, wahr und die Englischdidaktik beginnt, diesen Aspekt empirisch zu beforschen (z.B. Jakisch 2015). In der Schweiz wurde u.a. das Transferpotential vom Englischen zur zweiten Fremdsprache Französisch in deutschsprachigen Kantonen in einem umfassenden empirischen Projekt untersucht (vgl. den Beitrag Manno / Egli Cuenat im vorliegenden Band). Die Lateindidaktik leistet ihrerseits einen Beitrag zur Mehrsprachigkeitsdidaktik, indem sie über traditionelle, exemplarische Unterrichtsmodelle zur Vernetzung der alten und der modernen Fremdsprachen hinausgehend (z.B. Einzelbeiträge wie Fischbach 1981, Knittel 1981, Metzger / Ulrich 1995, vgl. auch den Band Nagel 1997 sowie Themenhefte wie Der Altsprachliche Unterricht 4, 2005: Latein und Romanische Sprachen ; 1, 2016: Latein und Spanisch ) fundierte Studien mit Blick auf das Vernetzungspotential zwischen Sprachen vorlegt (z.B. Siebel 2017) und das Potential des Lateinunterrichts zur Sprachförderung insgesamt, gerade auch für mehrsprachige Schülerinnen und Schüler, beforscht (z.B. Kipf 2014, Große 2017).
Читать дальше