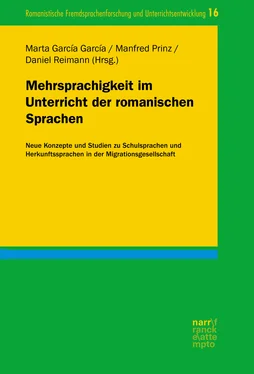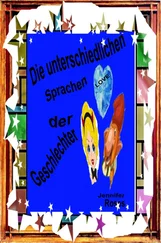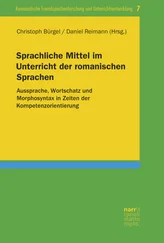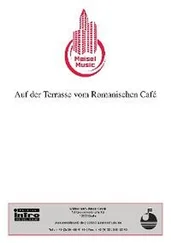Die Beiträge wurden nach inhaltlichen Schwerpunkten auf sechs Sektionen verteilt: Die Beiträge des ersten Blocks Aktuelle Fragestellungen zu Mehrsprachigkeit als Lernvoraussetzung und als Bildungsziel bilden einen konzeptionellen Rahmen des Bandes. Im Beitrag von Birgit Schädlichwird eine Systematisierung der Spannungsfelder unternommen, in denen sich sowohl der Diskurs um die schulische Mehrsprachigkeit als auch das Handeln von Lehrpersonen dychotomisch bewegen, nämlich zwischen Mehrsprachigkeit als Lernvoraussetzung bzw. als Ziel der schulischen Ausbildung einerseits sowie Mehrsprachigkeit verstanden als Gegenstand bzw. als Sprachgebrauch andererseits. Im Anschluss an die Ausführungen schlägt die Autorin mediatorisches Handeln und Symbolische Kompetenz als mögliche Ansätze vor, um diese Oppositionen konstruktiv im Fremdsprachenunterricht zu integrieren und insbesondere die Aspekte des Sprachgebrauchs und der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit mehr in den Fokus zu stellen. Andere mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze, die eher auf die Integration und Vernetzung von in der Schule erlernten Fremdsprachen abzielen, werden wie bereits erwähnt im RePA beschrieben. Im Beitrag von Anna Schröder-Surawird mittels ausgewählter Beispiele gezeigt, welche konkreten Möglichkeiten sowohl auf curricularer als auch auf unterrichtspraktischer Ebene der Einsatz der Deskriptoren des RePA bietet.
Beide Beiträge legen somit die Koordinaten fest, in denen sich die weiteren Beiträge – teils von eher empirischem, teils von eher praktischem Charakter – verorten lassen.
Ein aus der Perspektive der romanistischen Mehrsprachigkeitsdidaktik mitunter vernachlässigter Aspekt war und ist die Berücksichtigung und Integration der Alten Sprachen als Lernvoraussetzung bei der Aneignung einer romanischen Sprache. Aber auch die empirische Fundierung der konzeptionell und unterrichtspraktisch zwischenzeitlich durchaus angeregten Integration des Englischen (s.o.) steht bis dato weitgehend aus. Diesen Bereichen widmet sich der zweite Abschnitt Theoretische, empirische und unterrichtspraktische Erweiterungen des Konzepts I: Alte Sprachen, Englisch und schulische Mehrsprachigkeit mit Blick auf die romanischen Sprachen , in der aus empirischer und unterrichtspraktischer Perspektive der Fokus auf die sinnvolle Vernetzung der in der Schule erlernten Sprachen gelegt wird. Ein konkretes Beispiel dafür, wie die Sprachvernetzung in Lehrwerken gefördert werden kann, stellt der Beitrag von Katharina Wesselmanndar. Die Autorin zeigt anhand des von ihr mitkonzipierten Lehrwerks Aurea Bulla auf, wie die alte Sprache Latein ihre Funktion als Grundlage für die Aneignung weiterer Sprachen erfüllen kann: Ansätze der Interkomprehensionsdidaktik, der integrierten Sprachendidaktik sowie der Sprachenbewusstheit werden hier den jungen Lernenden in sehr ansprechender Form präsentiert. Lukas Eibensteinerund Johannes Müller-Lancésowie Giuseppe Mannound Mirjam Egli Cuenatwidmen sich der tatsächlichen Nutzung des Transferpotenzials vorgelernter Sprachen durch diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eine zweite bzw. dritte Fremdsprache lernen. Lukas Eibensteinerund Johannes Müller-Lancéerforschen diesen Aspekt mit Blick auf das Erlernen des verbalen Aspektes im Spanischen, Giuseppe Mannound Mirjam Egli Cuenatmit dem Schwerpunkt auf Erleichterungen durch Kognaten bei der Erledigung schriftlicher Aufgaben im Französischen als Zielsprache. Trotz der Unterschiede in den untersuchten Schulkontexten und in den Forschungsdesigns fallen die Ergebnisse beider Studien sehr ähnlich aus: In beiden Fällen kann konstatiert werden, dass eine Aktivierung von mehrsprachigen Lernstrategien stattgefunden hat, gleichwohl bleibt das Transferpotenzial der vorgelernten Sprachen vielfach unausgeschöpft.
Die zweite große im einleitenden Forschungsbericht beschriebene Dimension der aktuellen Mehrsprachigkeitsdidaktik, namentlich die der Einbeziehung von Herkunftssprachen in schulische Lehr-/Lernprozesse, wird im folgenden Abschnitt Theoretische, empirische und unterrichtspraktische Erweiterungen des Konzepts II: Herkunftssprachen und Fremdsprachenunterricht in den Blick genommen. Einerseits scheint es mitunter im schulischen Alltag an der Berücksichtigung von Herkunftssprachen zu mangeln, wie der Beitrag von Amina Kroppparadigmatisch zeigt. Die Autorin untersucht in ihrer Interviewstudie mit Lehrenden und (ehemaligen) Lernenden, inwiefern herkunftssprachliche Kenntnisse als Ressource für das Lernen weiterer Sprachen im Unterricht thematisiert und fruchtbar gemacht werden und stellt eine fehlende „multilinguale Überzeugung“ bei den Lehrpersonen fest. Dies steht im Einklang mit den negativen Erfahrungen der Lernenden, deren Mehrsprachigkeit sehr selten wertgeschätzt und einbezogen wurde. Aber nicht nur im Unterricht selbst, sondern auch im deutschen Schulsystem als Ganzem scheinen Defizite bezogen auf die Förderung und den Erhalt von Herkunftssprachen vorzuliegen. Dies untersucht Katja F. Cantoneam Beispiel des Italienischen. Ausgehend von der Diskussion ausgewählter Fälle wird veranschaulicht, wie sehr die Eltern bei der Weitergabe der Familiensprache(n) auf sich alleine gestellt sind. Zwar scheint ein flächendeckendes, staatliches Angebot von Herkunftssprachenunterricht derzeit unrealistisch und kaum praktikabel, dennoch belegt diese Untersuchung offensichtliche, strukturelle Defizite. Einen Sonderfall mehrsprachlich kompetenter Schülerinnen und Schüler stellen die Lernenden dar, die einen zielsprachigen Hintergrund aufweisen. Diesem besonderen Fall widmet sich der Beitrag von Daniel Reimannund geht der Frage nach, wie Schülerinnen und Schüler mit Spanisch als Familiensprache im Spanischunterricht behandelt und gefördert werden. Die zentralen Ergebnisse der schriftlichen, retrospektiven Befragung an Studierenden sowie der mündlichen Interviews mit Lehrenden und Schülerinnen und Schülern zeigen, dass die Einbeziehung der „muttersprachlichen“ Lernenden in den Unterricht zum einen für die Lehrkräfte als Herausforderung erlebt wird, da sie häufig einen Balanceakt zwischen Unterforderung und hoher Exposition der Schülerinnen und Schüler (z.B. als Experte, als Modell für die Mitlernenden) darstellt. Für die (ehemaligen) Schülerinnen und Schüler selbst besteht zum anderen der Wunsch (durch Zusatzleistungen noch) mehr gefordert zu werden. Im Einklang mit anderen Beiträgen des Bandes wird ebenfalls festgestellt, dass sie nicht im vollen Bewusstsein des Transferpotenzials ihrer Sprachenkenntnisse sind bzw. dies im Unterricht nicht explizit genug einbezogen wird.
In der vierten Sektion, die Konzeptionelle Anregungen zur Entwicklung eines sprachsensiblen Fremdsprachen- und Fachunterrichts mit Fokus auf Bilingual Education beinhaltet, werden beide Perspektiven (Mehrsprachigkeit als Voraussetzung und als Bildungsziel) in zweifacher Hinsicht thematisiert. Zum einen unterbreitet Christian Kocheinen unterrichtspraktischen Vorschlag, in dem das Modell der Förderung der indigenen Sprachen in den Andenstaaten als Unterrichtsthema und als Anregung zur Diskussion über den Status der Regional- sowie der Familiensprachen präsentiert wird. Zum anderen wird im Beitrag von Marta García Garcíaanhand der Analyse ausgewählter Plenumsgespräche aus einem bilingualen Modul die Verschränkung zwischen Fach- und (Fremd-) Sprachenunterricht beleuchtet. Außerdem werden Möglichkeiten aufgezeigt, die solch hybride Szenarien für die Unterrichtsfächer bieten.
In der fünften Abteilung wird die Förderung der Mündlichkeit in sprachsensiblen und nachhaltigen Unterrichtssettings in den Fokus genommen. Ausgehend von den Grenzen, die der GeR im Bereich der Aussprache und der Suprasegmentalia aufweist, stellt Clémentine Abelein für die Lehrkräfte sowie für die Lernenden nachvollziehbares Deskriptorenmodell der wesentlichen prosodischen Merkmale des Französischen vor, das beiden Zielgruppen Aufschluss über die zu erwartenden Kompetenzen im Bereich der Aussprache gibt. Die defizitäre Förderung der Sprechkompetenz im Französischunterricht, die von Carine Greminger Schibliund Lilli Papaloizosin ihrer Datenanalyse erkannt wird, ist die Grundlage zur Entwicklung eines Vorschlags, in dem zum einen die Arbeit mit den wichtigsten mündlichen Genres, zum anderen die metasprachliche Reflexion anhand der von den Schülerinnen und Schülern vertretenen Sprachen in den Vordergrund gestellt werden. Manfred Prinzuntersucht seinerseits in einem konzeptionellen und unterrichtspraktisch orientierten Beitrag die Rolle portugiesisch- und französischbasierter Kreolsprachen auf Cabo Verde und La Réunion. Ausgehend von soziolinguistischen und sprachpolitischen Betrachtungen zur Rolle der Kreolsprachen auch im Kontext postmoderner Theoriebildung stellt er, unter Rückgriff auf in seinem Projekt RapRomania entwickelte Prinzipien, fünf Textbeispiele zum Hör-(Seh-) und Leseverstehen luso- und frankokreolischer Texte vor.
Читать дальше