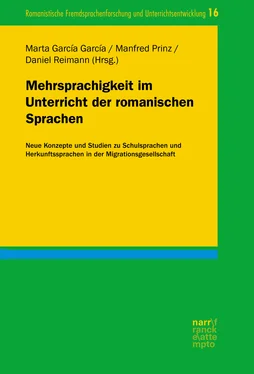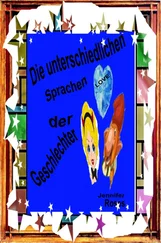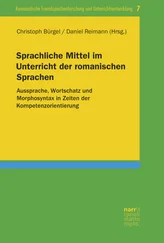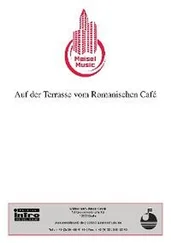1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Symbolische Kompetenz bedeutet zusammenfassend, Sprache nicht nur kommunikativ und interkulturell zu benutzen, sondern dabei auch ihre Wirkmechanismen zu durchschauen und diese für eigene Handlungsziele auch nutzen zu können. Die Nähe dieses Kompetenzziels zur Praxis des mediatorischen Handelns im Sinne von Translanguaging wird an dieser Stelle erkennbar: In beiden Fällen geht es um die Ausweitung bzw. Differenzierung der Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe (vgl. die Beispiele lebensweltlich mehrsprachiger Situationen bei Kramsch/Whiteside 2008) über sprachlich-kulturelle Aushandlungsprozesse. Dass diese als per se prozesshaft und unabgeschlossen angenommen werden, deckt sich mit dem Fokus, der oben für Mittlungsprozesse herausgearbeitet wurde. Über den semiotischen Aspekt von Sprachmittlung – v.a. im Sinne de Carlos – geht Symbolische Kompetenz jedoch noch hinaus: „In the late modern stance offered by an ecological perspective, symbolic competence is both semiotic awareness (van Lier 2004), and the ability to activley manipulate and shape one’s environment on multiple scales of time and space“ (Kramsh/Whiteside 2008, 667).
4.4 Ansätze für symbolisches Handeln in einem mehrkulturell orientierten Unterrichtsdiskurs
Symbolische Kompetenz als theoretischer Bezugsrahmen für sprachlich-kulturell plurales Handeln ist an sich kein fachdidaktisches Konzept. Soziolinguistische und erwerbstheoretische Arbeiten werden jedoch bei Kramsch in den Bereich institutionalisierten Sprachenlernens übertragen.
Damit stellt das Konzept – ähnlich wie das oben beschriebene Translanguaging – auch einen Versuch dar, zwischen deskriptiv-angewandter Linguistik und normativ-konzeptioneller Fachdidaktik zu mitteln. Kramschs Forschung bezieht sich einerseits auf Konversationsanalysen von Gesprächen unter Migrant*innen (vgl. Kramsch/Whiteside 2008) in authentisch-lebensweltlichen Alltagssituationen. Andererseits konkretisiert sie das Konzept immer wieder im Kontext schulischer und universitärer Sprachlehr-/lernprozesse, wobei sie das Augenmerk auf die Interdependenzen historischer, ästhetischer, und emotionaler Funktionen von Sprache und Macht als Lernziele im Sinne einer critical language awareness legt.
Es sollen im Folgenden zwei Beispiele aus Kramsch eigenen Arbeiten beschrieben werden, die auf die unterrichtspraktische Ebene abzielen. Diese gehen mit ihren inhaltlich-thematischen Vorschlägen im Sinne fachdidaktischer Konzepte über die stärker deskriptiven Analysen ihrer linguistischen Arbeiten hinaus und erlauben es Lehrpersonen, unterrichtliche Entscheidungen reflexiv zu rahmen.
Das erste Beispiel ist die Arbeit mit einem Werbeplakat des Pariser Kaufhauses Le bon marché , die Kramsch (1998) in „The Privilege of the Intercultural Speaker“ beschreibt. Hier geht es um Aushandlungsprozesse, die dann entstehen, wenn Lernende kulturelle oder intertextuelle Anspielungen – was Werbetexte unterrichtlich ebenso reizvoll wie schwierig macht – nicht verstehen, weil ihnen das relevante kulturspezifische Hintergrundwissen nicht verfügbar ist. Das „Privileg“ des interkulturellen Sprechers besteht nun darin, die verschiedenen Interpretationen, die sich aus den divergierenden Lesarten der Lerner ergeben (und die aus der Perspektive der Lehrkraft, die über das entsprechende kulturspezifische Wissen verfügt, „falsch“ erscheinen mögen), ihrerseits auf ihr Zustandekommen hin zu befragen. Auf diese Weise werden die Relativität von Wahrnehmungen und die mit ihnen verbundenen, ‚mächtigen’ Plausibilitäten Gegenstand von Diskussionen, bei denen auch das – aus der Lehrerperspektive zu vermittelnde – interkulturelle Wissen in den Aushandlungsprozess eingespielt werden kann. Hier geht es im Sinne der „Maximierung“ unterrichtlicher Interaktionen (vgl. (García/Wei 2015, 233) gerade nicht darum, die spontanen Bedeutungskonstruktionen der Lerner lediglich durch das zu vermittelnde kulturspezifische Wissen zu ersetzen, sondern darum, die pluralen Bezugspunkte ihrer Hervorbringung relational zu thematisieren und dadurch neue Bedeutungen – und neues Wissen – emergieren zu lassen.
Das zweite Beispiel findet sich in einem Unterrichtsvorschlag zur Arbeit an dem Text Als ich ein kleiner Junge war (1957) von Erich Kästner zu den Luftangriffen auf die Stadt Dresden am Ende des Zweiten Weltkrieges (vgl. Kramsch 2011). Hier zeigt Kramsch, wie sie den Übergang von der kommunikativen zur Symbolischen Kompetenz unterrichtlich gestaltet: An typischen Aufgaben zur Textarbeit, die traditionell eine Inhaltswiedergabe, rhetorische Analysen sowie eigene Stellungnahme der Lernenden einfordern, kritisiert sie, dass v.a. letztere häufig stereotyp ausfallen und wirkliche Aushandlungsprozesse oder Differenzen meist nicht entstehen. Im Gegenteil beobachtet sie eher, dass sprachliche Aushandlungen schnell beendet werden, der Unterricht stagniert und dabei stereotype Vorstellungen eingebracht werden, die gerade nicht in Frage gestellt oder relativiert werden, sondern rasch als Konsens etabliert sind. Sie erklärt dies am Beispiel des Textes von Kästner mit den stereotypen Vorstellungen amerikanischer Studierender zu Deutschland und zum Zweiten Weltkrieg, deren Argumentation häufig darauf basiere, dass diese „nicht nur keine Pazifisten sind, sondern die ihr Selbstbewusstsein darauf aufbauen, dass es im Krieg nur Gute oder Böse gibt, und dass sie selber immer auf der Seite der Guten stehen“ (Kramsch 2011, 39).1
Didaktisch stellt sie dem analytisch ausgerichteten Vorgehen eine alternative Unterrichtsdramaturgie gegenüber, welche eigene Produktionen der Lernenden in den Mittelpunkt der Analysen stellt und den Ausgangstext von Kästner auf diese Weise selbst intertextuell anbindet. Dadurch werden plurale kulturelle Aushandlungen anders initiiert, nämlich ausgehend von der eigenen Spracharbeit:
„Allerdings wird der interkulturelle Dialog manchmal durch inkompatible subjektive und historische Wertvorstellungen erschwert. Zu befördern ist er nicht durch direkten Fakten- und Informationsaustausch, sondern indirekt: durch die Freisetzung von persönlichem, subjektivem Affekt in der Arbeit an der Sprache selbst“ (Kramsch 2011, 40).
Die Produktion eigener Texte löst in ihrem Vorschlag die Analyse des Textes von Kästner das analytische Vorgehen ab: „Anlässlich des 60. Jahrestages der Bombardierung Dresdens erzählen Sie Ihrem Kind vom 13. Februar 1945“. Die Aufgabe setzt – wie es oben bereits im Kontext von Kompetenz- und Aufgabenorientierung ausgeführt wurde – bei einer sprachlichen Produktion an, die selbst zum Gegenstand der Analyse wird und nicht ausschließlich als nachgängige Stellungnahme zur Interpretation des Ausgangstextes verfasst wird.
Für das eigene Schreiben müssen Entscheidungen getroffen werden, und dabei werden die potenziell stereotypen Urteile, die Kramsch im textanalytisch orientierten Literaturunterricht beobachtet, zunächst einmal ersetzt durch Fragen, die durch die eigene Produktion bearbeitet werden: Wie spreche ich mit einem Kind über das Grauen? Was stelle ich ins Zentrum meiner Geschichte, was erzähle ich überhaupt und was lasse ich weg? Das sprachbildende Potenzial der Aufgabe liegt darin, dass die Komplexität des Themas subjektiv bearbeitet wird, nämlich über die Auseinandersetzung mit der Frage, wie etwas versprachlicht wird. In der sprachlichen Handlung greifen die Schreiber*innen auf das eigene Repertoire zurück. Ihre Geschichten zeigen, welche Formulierungen, Bilder, Erinnerungen an welche Sprachen und Geschichten geknüpft sind. Die eigenen Geschichten und ihre Analysen schaffen einen Zugang zu sprachlich-kulturellen Diskursen, in die sich die Lernenden einschreiben und die ihnen im Sinne der layered simultaneity (vgl. Kramsch/Whiteside 2008, 659) eingeschrieben sind. Die Texte zeigen, welche Erfahrungen ein historisches Ereignis wachruft – auch wenn die Schüler*innen vielleicht selbst nie einen Krieg erlebt haben2 – und wie historisches Wissen mit der eigenen Erfahrungswelt verknüpft wird.
Читать дальше