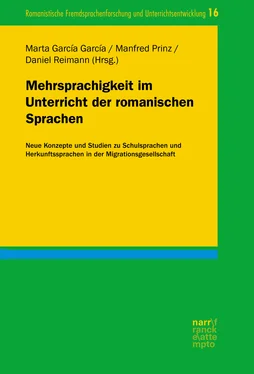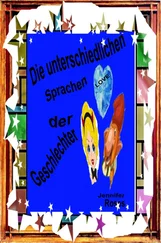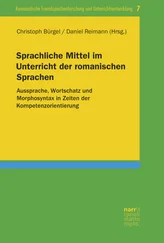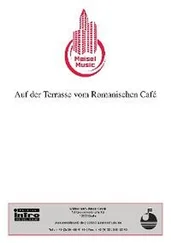Die Darstellung mehrsprachigkeitsbezogener Oppositionen hatte zunächst zum Ziel, unterschiedliche Ausrichtungen und Funktionen fremdsprachendidaktisch relevanter Aspekte von Mehrsprachigkeit zu systematisieren. Sie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Die Sprachlichkeit der Schüler*innen ist durch die Oppositionen Mehrsprachigkeit als Voraussetzung vs. Mehrsprachigkeit als Ziel von Fremdsprachenunterricht sowie lebensweltliche vs. schulische Mehrsprachigkeit gerahmt.
Ziele sprachlichen Lernens sind durch die Opposition Sprache als Gegenstand vs. Sprache als Kommunikationsinstrument gerahmt.
Unterrichtliches Handeln ist durch die Oppositionen systemlinguistische Metakognition vs. Bewusstmachung kommunikativer Strukturen sowie natürlichen vs. didaktisch angeleiteten Sprachgebrauchs gerahmt.
Forschung und Materialentwicklung sind durch die Opposition Deskriptivität vs. Normativität gerahmt.
In einem zweiten Schritt sollen als Ansatz zu der Frage, wie im Fremdsprachenunterricht das gesamte sprachliche Repertoire der Schüler*innen fruchtbar gemacht werden kann, die oben entworfenen Oppositionen nicht als sich gegenseitig ausschließende Fluchtpunkte forschenden Interesses und unterrichtlichen Handelns diskutiert werden, sondern als antinomische Spannungsfelder1, in denen sich die Entscheidungen von Lehrpersonen jeweils situativ und funktional verorten. Damit ist gemeint, dass es sich jeweils um Ausprägungen im Verständnis von Mehrsprachigkeit sowie fachdidaktischer Vorschläge zu mehrsprachigkeitsorientiertem Unterricht handelt, deren Legitimität und unterrichtliches Potenzial gleichermaßen anerkannt werden. Damit verschiebt sich der Fokus auf die Diskussion, welche Ausprägung in welcher Situation und mit welcher Funktion für sprachliche Lehr-/Lernprozesse akzentuiert wird und wie sich diese Akzentuierung im Lehrerhandeln realisiert. Dies stellt nicht nur für Personen, die sich forschend mit Unterricht beschäftigen und das Handeln von Lehrkräften rekonstruieren, eine mögliche Heuristik dar. Der Ansatz kann Lehrkräften auch helfen, potenziell widersprüchliche Handlungen zu erkennen und ihre didaktischen Entscheidungen hier zu verorten, also mehrsprachig reflexiv zu handeln.
Im Kontext der oben entworfenen Oppositionen seien im Folgenden exemplarisch solche Spannungsfelder skizziert, die Entscheidungen situativ und funktional rahmen können.
Unterrichtliches Handeln, das Mehrsprachigkeit zwischen Voraussetzung und Ziel, zwischen natürlichem und didaktisch indiziertem Sprachgebrauch, zwischen Gegenstands- und Mitteilungsfokus, zwischen Deskriptivität und Normativität akzentuiert, kann durchaus dazu führen, dass Fremdsprachenunterricht gegebenenfalls selbst die Ziele einer Orientierung an Mehrsprachigkeit unterwandert: So können beispielsweise jener Stelle Reibungen entstehen, an der Schüler*innen einerseits zu ihren sprachlichen Repertoires befragt werden – in diesem Sinne werden beispielsweise Sprachenportraits auch zunehmend nicht mehr nur als Instrument der Forschung, sondern auch im Unterricht selbst eingesetzt – und damit eine grundsätzliche Würdigung sprachlicher Diversität intendiert wird, die somit auf einer Ebene der Sprachbeschreibung auch stattfindet. Auf der Ebene des Sprachgebrauchs hingegen kann eine solche Offenheit gerade an der Stelle als Pseudo-Wertschätzung konterkariert werden, wo sie in der konkreten Kommunikation wieder zurückgenommen wird, beispielsweise dann, wenn Schüler*innen im Unterricht auf andere als die Zielsprache zurückgreifen oder sprachliche Unsicherheiten entstehen, die inhaltliche Aushandlungsprozesse erschweren oder unterbinden. Mehrsprachigkeitsorientierte Aufgaben beziehen sich meist explizit auf Sprachen schulischer Sprachenfolgen und integrieren die Repertoires der Lernenden häufig gar nicht oder sehr punktuell im Sinne einer isolierten Kognition lexikalischer oder morphosyntaktischer Elemente.
Busch (2013) zeigt in ihrer Analyse von Sprachenportraits eindringlich, dass das sprachliche Repertoire gerade nicht ausschließlich als positive Ressource wahrgenommen wird, sondern dass soziale Wertungen, in denen sich Sprachideologien manifestieren, den Sprachgebrauch bestimmen, wenn die Verfügbarkeit sprachlicher Ressourcen beispielsweise Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zu sprachlichen Gemeinschaften markiert: Das sprachliche Repertoire wird häufig gerade nicht – wie es auch der Repertoirebegriff des GER suggerieren könnte – als „Arsenal“ oder „Werkzeugkiste“ wahrgenommen, sondern ex negativo , in solchen Situationen nämlich, in denen sprachliches Handeln unmöglich oder eingeschränkt ist (vgl. Busch 2012, 14f.).
Als ein Beispiel für antinomische Spannungen im natürlichen vs. didaktisch indizierten Sprachgebrauch können Entscheidungen zur Unterrichtssprache genannt werden, in denen sich widersprüchliche Anforderungen wie die folgenden zeigen können: Auf der einen Seite steht das Bemühen (und dahinter die curricular gesetzte Anforderung), die Zielsprache als Unterrichtssprache möglichst durchgängig zu etablieren, auf der anderen Seite der Anspruch, die Repertoires der Schülerinnen zu nutzen, was auch eine Entfernung von der Zielsprache bedeuten kann. Hier wiederum entstehen Sprachhierarchien und -präferenzen, die curricular begründet sind, aber sich nicht zwangsläufig mit den Repertoires der Lernenden decken.
Diese bestimmen Entscheidungen zum Sprachgebrauch im Unterricht, wobei Sprachen, auf die funktional zurückgegriffen wird, gegebenenfalls nicht für alle dieselben sind. Hier wird im Spannungsfeld von Mehrsprachigkeit als Voraussetzung (Einbezug von Herkunftssprachen) und Ziel (Orientierung an schulischen Sprachenfolgen) agiert. Lehrkräfte möchten einerseits alle Sprachen würdigen und deren Gleichwertigkeit anerkennen, durch die Förderung oder Sanktionierung schülerseitiger Entscheidungen im Sprachgebrauch stellen sie aber zwangsläufig Priorisierung und Hierarchisierung akzeptierter (und nicht akzeptierter) Unterrichtssprachen her (vgl. Bogner/Gutjahr 2019).
Die skizzierten antinomischen Spannungsfelder sollen im Folgenden als konzeptionelle Rahmung für einen mehrsprachigkeitsorientierten Fremdsprachenunterricht dienen, der sowohl den Aspekt „Mehrsprachigkeit als Voraussetzung von Unterricht“ akzentuiert als auch den Sprachgebrauch ins Zentrum didaktischer Überlegungen rückt.
4 Ansätze für reflektierte Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht: Mediatorisches Handeln und Symbolische Kompetenz
Reflektiertes mehrsprachiges Handeln durch Lehrpersonen bedeutet zusammenfassend, antinomische Spannungsfelder als solche anzuerkennen und im Unterrichtshandeln ex ante , situativ und ex post auszugestalten. Ein solcher Unterricht ist mehrsprachigkeitsorientiert in dem Sinne, als er die mehrsprachigen Repertoires der Lerngruppe sowie die Ziele ihrer Erweiterung durch Fremdsprachenunterricht (Antinomie „Voraussetzung und Ziel“) berücksichtigt. Reflektierte Mehrsprachigkeit akzentuiert dabei gleichermaßen unmittelbar kommunikative Kompetenzen, wie auch mittelbar metasprachlich reflexive Kompetenzen, deren Verbindung als lernförderlich angenommen wird (Antinomie „Gegenstand und Sprachgebrauch“).
Auf diese Weise wird die gegenstandsorientierte und metasprachlich fokussierte Didaktik der Mehrsprachigkeit zu einer stärker gebrauchsorientierten mehrsprachigen Didaktik, wie es Zarate/Lévy/Kramsch (2008, 438) im Ausblick ihres Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme formulieren:
„Comparée à la didactique du plurilinguisme, une didactique plurilingue et pluriculturelle sous-tend une manière différente d’apprendre et de vivre les langues. La langue n’est plus un objet dont les structures […] sont normées par l’Académie, codifiés par les dictionnaires […] contrôlés par les institutions scolaires. C’est la ‚parole’ saussurienne […] par chaque sujet ou groupe qui se constitue dans l’interaction didactique, y compris celle du maître. Cette parole est plurielle : parlée, façonnée, construite et modifiée par des milliers d’interlocuteurs natifs et non-natifs, de cultures elles-mêmes diversifiées, changeantes, hybrides et constamment renouvelées. La parole, porteuse de représentations sociales et culturelles, elles-mêmes liées à des lieux de mémoire, plus ou moins distants dans le temps et l’espace, devient un espace par excellence qu’il s’agit d’identifier non seulement sous ses aspects référentiels, mais aussi et surtout sous ses aspects sociolinguistiques, pragmatiques et discursifs.“
Читать дальше