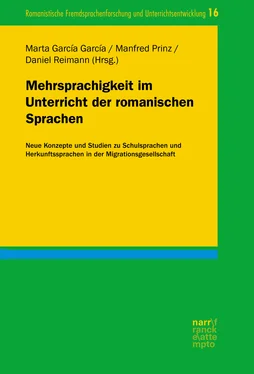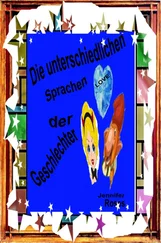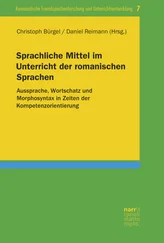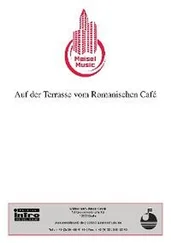1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 „… process by which students and teachers engage in complex discursive practices that include ALL the language practices of ALL students in a class in order to develop new language practices and sustain old ones, communicate and appropriate knowledge, and give voice to new sociopolitical realities by interrogating linguistic inequality“ (García/Kano 2014; zit. in García/Wei 2015, 225).
4.2 Ansätze für mediatorisches Handeln in einem mehrsprachigkeitsorientierten Unterrichtsdiskurs
Für die Schwierigkeit situativer Entscheidungen zu mehrsprachigem Handeln existieren keine unterrichtspraktischen passe-partout -Lösungen. Dennoch lassen sich aus empirischen Arbeiten, die unterrichtliche Interaktionen rekonstruieren, zumindest Ansätze abstrahieren, die als Reflexionskategorien in Entscheidungssituationen fungieren können. Exemplarisch sei hier auf die Analysen von Nicolas (2012) und Ziegler/Sert/Durus (2012) zu realiter beobachteten mehrsprachigen Interaktionen des Fremdsprachenunterrichts verwiesen. Nicolas rekonstruiert beispielsweise den „refus de l’anglais par l’enseignant“ (Nicolas 2012, 374) mitsamt der unterliegenden subjektiven Theorie eines einsprachig zu haltenden Unterrichts. Mit Cicurel bezeichnet Nicolas die Lehrperson als „sprachgefräßig“ („linguaphage“) im Sinne einer Vereinnahmung der Rede: „Le discours didactique présente la caractéristique d’être un discours qui avale la parole de l’autre. Le professeur […] provoque la parole, il la canalise, il l’arrête ou la reprend pour continuer à susciter une autre parole ou pour alimenter son discours pédagogique“ (Cicurel, 1990, 54; zit. in Nicolas 2012, 376). In Nicolas’ Beispielen aus dem Français langue étrangère- Unterricht wird schülerseitiges Aushandeln eher abgekürzt als gefördert; es wird also gerade nicht versucht, inhaltliche Aushandlungen zu maximieren (vgl. García/Wei 2015, 233). Lehrkräfte, die sich dieser Mechanismen bewusst sind, können entscheiden, an entsprechenden Stellen anders zu reagieren. Hierzu beleuchten die Analysen von Ziegler/Sert/Durus (2012) unter dem Stichwort des „next-turn-management“ typische Interaktionsmuster mehrsprachiger Unterrichtskommunikation. Zusammenfassend plädieren sie für folgende Strategie:
„The teacher first accepts the use of multilingual ressources through a go-ahead token and, after a second use, repairs it by reference to the classroom preferencial language mode“ (Ziegler/Sert/Durus 2012, 2000).
Im Detail unterscheiden sie zwischen veränderter Wiederaufnahme einer Schüleräußerung („modified repetition“), ihrer einsprachigen Umformulierung („monolingual reformulation“) oder der Initiierung eines metasprachlichen Diskurses („meta-talk about language“).
Zusammenfassend nimmt mediatorisches Handeln zwischen Sprachmittlung und Translanguaging die Spannungsfelder von Mehrsprachigkeit als Voraussetzung und Ziel auf sowie unterrichtliches Handeln in eher planerisch-zielsprachlich fokussierter und in eher situativ-adaptiver, sprachlich offener Hinsicht auf. Eher lehrerseitig konzipierte Sprachmittlungsaufgaben und eher schülerseitig initiierte Prozesse „natürlicher“ Mittlungsprozesse stehen sich dabei nicht ausschließend gegenüber, sondern als Ausprägungen mehrsprachigkeitsorientierten unterrichtlichen Handelns, das die sprachlichen Ressourcen der Schüler*innen für zielsprachliches Lernen fruchtbar macht. Damit ist nicht intendiert, im Französischunterricht systematisch auch produktive Kompetenzen in anderen Sprachen zu vermitteln. Vielmehr geht es im Sinne einer Förderung inhaltsbezogener Aushandlungsprozesse darum, lernersprachliches mehrsprachiges Handeln dort, wo es die inhaltsbezogene Kommunikation maximieren kann, nicht vor einem gegebenenfalls hinderlichen Prinzip des „einsprachigen Unterrichts“ zu unterbinden.1
4.3 Symbolische Kompetenz zwischen angewandter Linguistik und Fremdsprachendidaktik
Das Konzept der Symbolischen Kompetenz sensu Kramsch (2006, 2009, 2011) wird hier als weiterer Ansatz für reflektierte Mehrsprachigkeit mit einem besonderen Fokus auf inter- bzw. mehrkulturelles Handeln im Fremdsprachenunterricht vorgestellt1. Sie berührt die Antinomie von Deskriptivität und Normativität, die sich hier im Transferversuch soziolinguistischer Arbeiten in den Bereich unterrichtlicher Aufgabenentwicklung manifestiert.
Symbolische Kompetenz erscheint sowohl als Konzept als auch als Kompetenzziel geeignet, die plurale Bezüglichkeit kultureller Handlungen im Unterrichtsdiskurs zu rahmen. Kramsch hat sich in ihren kulturdidaktischen Arbeiten vor allem mit der Frage beschäftigt, wie eine potenziell deterministische und dichotomisierende Vorstellung von Kultur, die Fremdsprachenunterricht häufig unterliegt, durch diskursive und plural orientierte Kulturbegriffe ausgeweitet werden kann.
Gerade vor dem Hintergrund der häufig bereits vorhandenen zwei- oder mehrsprachigen Identität von Sprachenlernenden werden Dichotomien wie Ausgangs- und Zielsprache ebenso wie Ausgangs- und Ziel kultur als Bezugsgrößen für schulisches Fremdsprachenlernen fragwürdig: „D’une autre part, des expressions comme ‚dialogue des cultures’ semblent transférer au domaine culturel la métaphore d’une relation binaire“ (Coste/Moore/Zarate 2009, 10). Dabei schreiben Coste/Moore/Zarate – im Gegensatz zu Kramsch – dem Präfix „inter-“ zu, gerade nicht „Gegenüberstellung“, sondern „dynamische Relation“ zum Ausdruck zu bringen: „[…] indicateur de relation et non de simple juxtapposition“ (Coste/Moore/Zarate 2009, 10). Das Interkulturelle wird als Relation zweier Kulturen oder die Existenz eines „Zwischen den Kulturen“ einerseits, sowie als ein „plus de deux“ andererseits beschrieben, was über die Synonyme „intersection, interpénétration, interférence ou inter-construction et inter-définition de plusieurs cultures“ (Coste/Moore/Zarate 2009, 10) erläutert wird. Diese Vorstellung wird im Präfix „pluri“ – „entendu comme ‚plus de deux’“ (Coste/Moore/Zarate 2009, 10) ausgeweitet.2
Kramsch hat sich in ihren kulturdidaktischen Arbeiten zunächst mit der Figur des Dritten Raums beschäftigt und versucht, die Metapher des Third Space des Kulturtheoretikers Homi K. Bhabha (vgl. Bhabha 1994) fruchtbar zu machen, dann aber auch dieses Konzept im Ansatz der Symbolischen Kompetenz weiter abstrahiert (vgl. die ausführliche Diskussion und Kritik des Konzepts bei Plikat 2017, 141f.). Maßgeblich für ihren Kulturbegriff wird der Nexus von Kultur und Sprache, den sie an den Diskursbegriff koppelt. In Anlehnung an Clifford Geertz’ (1973) Vorstellung von Kultur als von Menschen hergestelltes Bedeutungsgewebe definiert sie kulturelle Praxis per se als textliche Praxis. Kulturelles Handeln ist damit sprach- – oder noch abstrakter gefasst – grundsätzlich zeichengebunden. Damit versteht sie Kulturen auch nicht lediglich als Räume, in denen sich Akteure bewegen und nur auf eine bestimmte, deterministische Art bewegen können. Kulturen als sprachlich oder zeichenhaft Hervorgebrachtes sind dynamisch und immer an die Prozesse ihrer Hervorbringung gekoppelt.
Symbolische Kompetenz3 leitet Kramsch in Anlehnung an Larsen-Freemans (1997) Komplexitätstheorie her und kontextualisiert sie mit Arbeiten zur Sprachenökologie, die sie für den Bereich der Fremdsprachenforschung mit den Arbeiten van Liers (2004)4 assoziiert. Symbolische Kompetenz zeichnet sich durch fünf Dimensionen aus: Das Wissen um die Relativität des Selbst und des Anderen (erste Dimension) verweist auf die Dynamik des Verhältnisses kultureller Größen wie „Eigen“ und „Fremd“, die „intrinsically pluralistic“ (Kramsch/Whiteside 2008, 659) sind, sowie auf deren Hervorbringung durch sprachliche Aushandlungsprozesse. Letztere sind zeitlich und räumlich gerahmt, das heißt, Äußerungen können verschiedene Zeitebenen (zweite Dimension der Time Scales ) unterliegen, die auf eine layered simultaneity (vgl. Blommaert 2005, 130) verweisen. Diese Schichten können bewusste Erinnerungen sein, aber auch unbewusste, gleichsam in den Körper eingeschriebene Bilder, die den Bezugspunkt des Sprechens darstellen: „meanings expressed through language operate on multiple timescales, with unpredictable, often unintended outcomes and multiple levels of truth and fantasy, reality and fiction“ (Kramsch/Whiteside 2008, 659). Sie können bei verschiedenen Sprechern stark divergieren, so dass Anpassungs- und Vermittlungsprozesse notwendig werden, um einen gemeinsamen Bedeutungsraum herstellen zu können. Diese werden als emergente Prozesse (dritte Dimension) verstanden. Der Begriff der „Emergenz“ verweist darauf, dass Bedeutung nicht durch die „Anwendung“ erlernter, standardisierter Kommunikationsschemata entsteht, sondern dass der Interaktionsprozess selbst etwas hervorbringt, aus dem für die Gesprächsteilnehmenden Bedeutung in einer spezifischen Situation (und für diese) entsteht. Diese Prozesse sind per se unabgeschlossen (vierte Dimension) und über sich selbst hinausweisend. Im Sprechen werden Zeiten und Räume aufgerufen, die außerhalb der Situation liegen, aber die Interaktion indirekt bestimmen. Hierfür ist der Begriff der „Deterritorialisierung“ (vgl. Kramsch/Whiteside 2008, 660) bedeutsam, der von Kramsch vor allem als Kontrapunkt zu einem nach wie vor stark lokale Identitäten und nationale Kulturbegriffe fokussierenden Fremdsprachenunterricht gezeichnet wird. Die Komplexität solcher Diskurse belegt Kramsch mit der Metapher des Fraktals (fünfte Dimension), bei dem einzelne patterns sich ähneln, aber räumlich und zeitlich sowie in der Größe differieren können (vgl. Kramsch/Whiteside 2008, 659f.).
Читать дальше