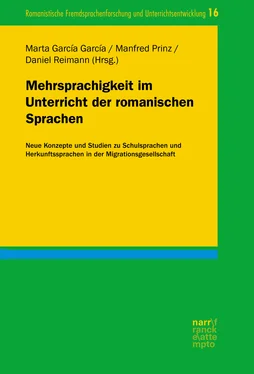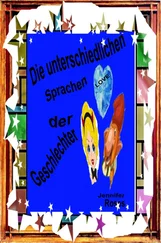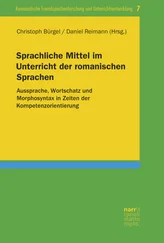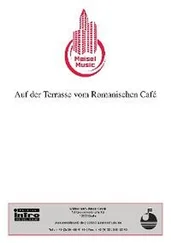An dieser Stelle setzt der metasprachliche Unterrichtsdiskurs an, der auf einen Nachvollzug der unterschiedlichen diskursiven Herstellung symbolischer Bedeutung und ihrer Verknüpfung zielt. Der bewusstmachende Aspekt im Sinne einer critical language awareness (Fairclough 2001) ist hier von einer Akzentverschiebung geprägt: Die im Kontext von Sprachbewusstheit häufig fokussierte Ebene des Sprachsystems wird hier erweitert um das Verstehen konkreter Sprachverwendung und ihrer kommunikativen Funktionen.
5 Zusammenfassung und Ausblick
In Anbindung an die eingangs beschriebenen Oppositionen und antinomischen Spannungsfelder können die Aspekte Mehrsprachigkeit, mediatorisches Handeln und Symbolische Kompetenz als Fluchtpunkt sowohl für die konzeptionelle Ebene der Unterrichtsgestaltung als auch für die deskriptive Ebene empirischer Unterrichtsforschung angesetzt werden. Dabei wurde mehrsprachigkeitsorientiertes Handeln im Spannungsfeld zwischen Unterrichtsplanung und spontaner Adaptivität als reflektierte Mehrsprachigkeit bezeichnet. Auf der Ebene der Unterrichtsgestaltung bedeutet mehrsprachigkeitsorientiertes Handeln das Schaffen von Räumen, in denen Mehrsprachigkeit zugelassen und plurale Aushandlungsprozesse maximiert statt verengt werden. Die gestalterische Aufgabe von Lehrkräften liegt in diesem Sinne nicht nur in der Konzipierung von Aufgaben – beispielsweise zu Mittlungssituationen –, sondern vor allem in der Auseinandersetzung mit der Frage, ob und wie mehrsprachige Prozesse der Unterrichtskommunikation begleitet werden können. Durch das eigene mediatorische Handeln können Lehrkräfte als Modell für ähnliche kommunikative Prozesse zwischen den Schüler*innen fungieren.
Empirische Arbeiten zu mehrsprachigkeitsorientiertem Unterricht decken wiederholt Brüche zwischen den grundsätzlichen Einstellungen von Lehrkräften und den tatsächlichen Arbeitsweisen auf, die diesen Einstellungen nicht entsprechen (vgl. Heyder/Schädlich 2011; Göbel/Vieluf/Hesse 2010). Daher erscheinen für die Unterrichtsforschung vor allem Arbeiten vielversprechend, die lehrerseitige Entscheidungen und mit diesen verbundene Unterrichtsinteraktionen beschreibend zugänglich machen. In welchen antinomischen Spannungsfeldern von Mehrsprachigkeit verortet sich konkretes Lehrerhandeln und welche Entscheidungen werden hier getroffen? Wie lassen sich Interaktionsprozesse beschreiben, durch die plurale sprachlich-kulturelle Räume geschaffen werden und welche Funktion kommt ihnen für zielsprachliche und generell sprachliche Erwerbsprozesse zu?
Forschungsmethodisch seien hierfür Kombinationen stärker deskriptiv-rekonstruktiver Arbeiten mit solchen vorgeschlagen, die alternative Konzepte – beispielsweise mehrsprachigkeitsorientierter Materialien und Aufgaben – in Interventionen implementieren.
Als Beispiel sei an dieser Stelle auf eine Masterarbeit, die an der Universität Göttingen entstanden ist, verwiesen: Mardt (2018) hat über ethnographische Beobachtungen von Französischunterricht eine Grounded Theory (vgl. Strauss/Corbin 1996) zu unterrichtlichen Interaktionsmustern entwickelt. Dabei konnte sie schüler- und lehrerzentrierte Muster beobachten, die im Zusammenhang mit mehrsprachigkeitsorientierten Unterrichtspraktiken stehen. Lehrerzentrierte Interaktion fokussiert stärker schulische Mehrsprachigkeit und deren systemlinguistische Kognition, während eher bedeutungsaushandelnde und – allerdings nur in einem Fall beobachtbare – lebensweltliche Mehrsprachigkeit integrierende Interaktionen eher schülerseitig stattfinden. Im beobachteten Französischunterricht spielt Mehrsprachigkeit in einem weiten Begriffsverständnis kaum eine Rolle und verengt sich in den Beobachtungen auf die Frage der Unterrichtssprache.
Wenn auch in diesem Beitrag mehrsprachigkeitsorientiertes Arbeiten als erwerbsförderlicher Ansatz charakterisiert und mediatorisches Handeln sowie Symbolische Kompetenz als Ansätze vorgestellt wurden, die hierfür sowohl unterrichtsplanerisch als auch im Sinne empirischer Unterrichtsforschung eine gegenstandstheoretische Rahmung darstellen können, so sei abschließend auf einige Aspekte, die problematisch und noch nicht ausreichend berücksichtigt erscheinen, hingewiesen.
Der erste Aspekt bezieht sich auf die konkrete sprachliche Konstellation in einer Lerngruppe. Es ist davon auszugehen, dass nicht jede Zusammensetzung in gleicher Weise ähnliche mehrsprachigkeitsorientierte Praktiken nahelegt oder ermöglicht. Hier könnte beispielsweise relevant werden, ob in einer Gruppe eine Sprache nur durch eine Person repräsentiert ist oder durch mehrere, so dass in einer Gruppe andere Arten von Aushandlungsprozessen stattfinden und mittelnde Prozesse eher erleichtert oder erschwert werden. Konzepte von Translanguaging postulieren zwar, dass die förderlichen Aushandlungsprozesse per se nicht an bestimmte Einzelsprachen gekoppelt sind und die multimodalen Aushandlungsprozesse über einzelsprachliche Kategorisierungen hinausgehen. Die empirischen Situationen, die beispielsweise den Arbeiten von García unterliegen, beziehen sich aber meist auf bilinguale Konstellationen, in denen Englisch und Spanisch dominante Bezugssprachen sind und auch jeweils mehreren Beteiligten zur Verfügung stehen.
Der zweite problematische Aspekt, der auch mit den Gegebenheiten situativer Konstellationen verbunden ist, berührt die Frage spezifischer kommunikativer Situationen des Fremdsprachenunterrichts. Während sich die empirischen Arbeiten sowohl im Kontext von Translanguaging als auch im Kontext Symbolischer Kompetenz auf lebensweltliche Mehrsprachigkeit beziehen, ist der Fremdsprachenunterricht qua situativer Rahmung und in seiner Zielsetzung der Aneignung einer lebensweltlich gerade nicht – oder noch nicht – relevanten Sprache von sprachlich-kulturellen Aushandlungsprozessen gekennzeichnet, die nur in bedingtem Maße Parallelen zu den empirisch rekonstruierten Situationen der Arbeiten von García oder Kramsch aufweisen. Dies betrifft in erster Linie die Eigenarten unterrichtlicher Interaktionen in ihrem Verhältnis zu außerschulischer Kommunikation.
Die Arbeiten zu Symbolischer Kompetenz übertragen soziolinguistische Beobachtungen in lebensweltlich authentischen Kontexten auf den Fremdsprachenunterricht. Die hierbei abstrahierten Kommunikationsmuster sind einerseits aufschlussreich für das Funktionieren symbolischer Aushandlungsprozesse. Andererseits stellt sich die Frage, inwieweit die spezifische Kommunikationssituation des Fremdsprachenunterrichts nicht auch durch andere typische Interaktionsverläufe geprägt ist, die einen unmittelbaren Übertragung problematisch erscheinen lassen müssen. Unterricht ist eine eigene „authentische Situation“, die von ihr zugehörigen interaktionalen Mustern geprägt ist (vgl. Cicurel 2005; Ehlich 1981; Seedhouse 2004), welche für empirische Arbeiten zur Kenntnis genommen und beim Versuch des Transfers soziolinguistischer Arbeiten in den fachdidaktischen „Raum“ einbezogen werden müssen.
Als Beispiel hierfür kann das von Gutjahr/Bogner (in diesem Band) beschriebene, mit der Autorin gemeinsam durchgeführte Lehrforschungsprojekt gelten. Die Studierenden werden als zukünftige Fremdsprachenlehrkräfte sowohl für verschiedene Diskurse zu Mehrsprachigkeit sensibilisiert, als auch in eigenen Forschungsprojekten begleitet. Der Fokus liegt auf Unterrichtsbeobachtung sowie Interaktionsanalysen in Verbindung mit der Planung und Reflexion eigenen unterrichtlichen Handelns. Das Projekt integriert in diesem Sinne die kritische Auseinandersetzung mit soziolinguistischen und fachdidaktischen Systematisierungsvorschlägen des Phänomens „Mehrsprachigkeit“ sowie gleichzeitig eine handlungsorientierte Einübung in die unterrichtliche Transformation pluraler mehrsprachigkeitsorientierter Ansätze. Beide Ebenen dienen hierbei dem Ziel, reflektierte Mehrsprachigkeit stärker in den Fokus angehender Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer zu rücken.
Читать дальше