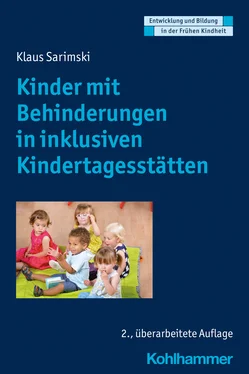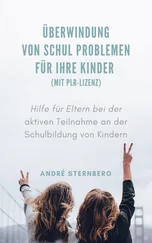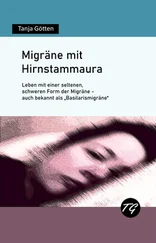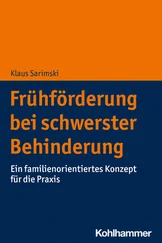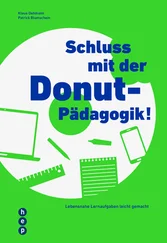Die Einstellungen, mit denen nicht behinderte Kinder den Kindern mit Behinderungen in ihrer Gruppe begegnen, orientieren sich darüber hinaus daran, welche Haltungen der Erwachsenen sie in ihrer Umgebung beobachten. Wenn sie erleben, dass Eltern oder pädagogische Fachkräfte Andere aufgrund äußerer Merkmale abwerten oder behinderten Menschen mit Vorurteilen oder großer innerer Distanz begegnen, prägt das ihre Einstellung. Es hilft ihnen, wenn sie von den Erwachsenen auf Fähigkeiten der behinderten Kinder aufmerksam gemacht werden, die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen wahrnehmen und eine ihrem Verständnisvermögen entsprechende Aufklärung über die Art und Entstehung der jeweiligen Behinderung erhalten.
1.3.4 Sorgen von Eltern und pädagogischen Fachkräften in der Planung sozialer Integrationsmaßnahmen ernst nehmen
Die Ergebnisse der Befragungen von Eltern und pädagogischen Fachkräften müssen ernst genommen werden. Sie weisen auf wichtige Bedingungen für das Gelingen sozialer Teilhabe hin. Pädagogische Fachkräfte brauchen eine personelle und räumliche Ausstattung im Kindergarten, die es ihnen möglich macht, sowohl den Bedürfnissen der behinderten Kinder wie auch dem Bildungs- und Förderauftrag gegenüber den nicht behinderten Kindern gerecht zu werden. Sie brauchen Fortbildung, um die Besonderheiten der Entwicklung unter den Bedingungen einer bestimmten Behinderung besser verstehen zu können und müssen pädagogische Maßnahmen kennen lernen, mit denen die Anregungen für die Entwicklung behinderter Kinder in den normalen Gruppenalltag integriert und soziale Kontakte zu den nicht behinderten Kindern gezielt unterstützt werden können ( 
Kap. 3
und 4
). Sie brauchen schließlich ein verlässliches Netzwerk von Kooperationsbeziehungen mit Frühförderstellen und anderen Facheinrichtungen, von denen sie Beratung und fachlich qualifizierte Unterstützung erhalten können, um die mit der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (und mitunter Verhaltensmustern) verbundenen Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können, ohne sich selbst zu überfordern ( 
Kap. 5
).
In Deutschland finden sich sehr unterschiedliche Formen sozialer Integration behinderter Kinder in KiTa und Schule. Zudem ist das Angebot von Integrationsplätzen in KiTas von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Erfahrungen liegen aus Modellprojekten vor und zeigen, dass die pädagogischen Fachkräfte die Integrationschancen grundsätzlich positiv, bei einzelnen Behinderungsformen jedoch skeptisch beurteilen. Auch die Eltern behinderter und nicht behinderter Kinder stehen der Integration überwiegend positiv gegenüber, haben jedoch je eigene Vorbehalte.
1.3.6 Empfohlene Literatur zur Vertiefung
Albers, T. (2011). Mittendrin statt nur dabei. Inklusion in Krippe und Kindergarten. München: Reinhardt.
Das Buch vermittelt eine Übersicht über rechtliche Grundlagen, die verschiedenen Dimensionen von Vielfalt in der Frühpädagogik sowie zur Gestaltung pädagogischer Prozesse und zur Kooperation mit Familien.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). (2008). Auf den Anfang kommt es an! Perspektiven zur Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland. Weinheim: Beltz.
Das Handbuch begründet ausführlich die Notwendigkeit eines quantitativen Ausbaus von Tageseinrichtungen und einer Verbesserung ihrer pädagogischen Qualität und formuliert Empfehlungen für die Professionalisierung der Fachkräfte, der Zusammenarbeit zwischen Tagesstätte und Familie, der Förderung von Kindern mit einem anderen kulturellen Hintergrund und der Vernetzung mit anderen Bereichen des Bildungssystems. Der Berücksichtigung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Heimlich, U. (2013). Kinder mit Behinderung – Anforderungen an eine inklusive Frühpädagogik. Eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF). München: Deutsches Jugendinstitut.
Übersicht über die Entwicklung inklusiver Pädagogik in Deutschland, Rechtsgrundlagen sowie Voraussetzungen für das Gelingen sozialer Teilhabe.
Kobelt Neuhaus, D. (2001). Qualität aus Elternsicht – Gemeinsame Erziehung von Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Behinderung. Seelze: Kallmeyer’sche Verlagsbuchhandlung.
Detaillierte Darstellung der Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen Erhebung zu Erfahrungen und Sichtweisen von Eltern integrativ betreuter Kinder mit ergänzenden Beobachtungen aus den Gruppenprozessen und Standards für gelingende Integrationsmaßnahmen.
Pluto, L. & van Santen, E. (2017). Kindertageseinrichtungen auf dem Weg zur Inklusion? Empirische Befunde zu Stand, Voraussetzungen und Barrieren. In U. Stenger, D. Edelmann, D. Nolte & M. Schulz, (Hrsg.), Diversität in der Pädagogik der frühen Kindheit. Im Spannungsfeld zwischen Konstruktion und Normativität (S. 199-218). Weinheim: Beltz Juventa.
Übersichtsarbeit zu Voraussetzungen und Barrieren der Inklusion in Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage von Daten einer Erhebung des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahre 2012.
1Soweit in diesem Text die weibliche oder männliche Form zur Bezeichnung von Fachpersonen verwendet wird, sind Personen des jeweils anderen Geschlechtes mit eingeschlossen.
2https://www.bertelsmann-stiftung.de/…/Studie_IB_Klemm-Studie_Inklusion_2015.pdf
3 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Unterwegs-zur-inklusiven-Schule_2018.pdf
2 Bedingungen und Wirkungen sozialer Integration
Dieses Kapitel – wie auch alle folgenden – soll mit einem Zitat aus einer Befragung zu elterlichen Erwartungen eingeleitet werden, das auf wichtige Aspekte von Qualitätsstandards für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder hinweist:
Um sowohl das jeweilige individuelle Kind und die Gemeinschaft aller Kinder und ihrer Familien angemessen berücksichtigen zu können, brauchen Pädagogen nicht nur solides pädagogisches Grundwissen. Gerade da, wo viele unterschiedliche Kinder zusammenkommen, werden fundierte entwicklungspsychologische Kenntnisse und Wissen über die Entwicklung von Gruppen und Gemeinschaftsfähigkeit besonders bedeutungsvoll. (Kobelt Neuhaus, 2001, S. 35)
2.1 Soziale Kompetenz von Kindern im Kindergarten
Nach den ersten Modellversuchen zur Frage, unter welchen strukturellen Bedingungen integrative Erziehung möglich ist, hat es in Deutschland zunächst kaum neue wissenschaftliche Impulse und Einsichten zum Thema Integration gegeben. Studien, die empirisch die Bedingungen für das Gelingen integrativer Erziehung untersucht haben, stammen daher überwiegend aus den USA und den skandinavischen Ländern. Dabei werden unterschiedliche Kriterien für das Gelingen integrativer Förderung verwendet:
• die Häufigkeit sozialer Kontakte behinderter und nicht behinderter Kinder in der Gruppe;
• der soziale Status behinderter Kinder in der Gruppe;
• die Ausbildung von Freundschaften zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern.
Die Verwendung dieser unterschiedlichen Kriterien deutet bereits darauf hin, dass es sich bei der Beurteilung des Gelingens sozialer Integration jeweils um eine relative Einschätzung handelt, denn selbstverständlich gibt es auch innerhalb der Gruppe der nicht behinderten Kinder solche mit wenigen sozialen Kontakten, die wenig Anerkennung in der Gruppe finden und kaum Freunde haben.
Читать дальше