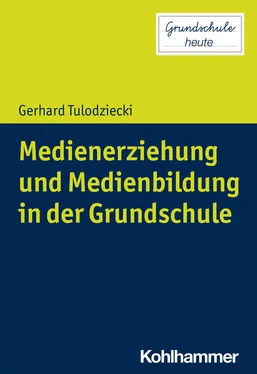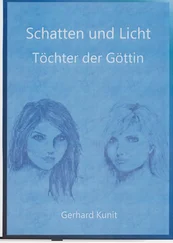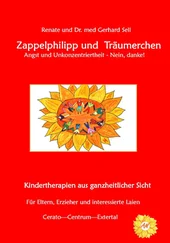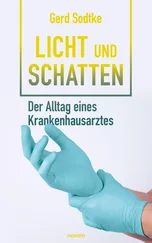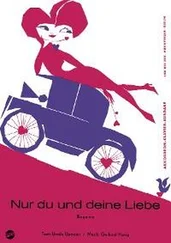Digitalisierung und digitale Infrastruktur: Gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen im Medienbereich hängen wesentlich mit der Digitalisierung zusammen. Diese hat mittlerweile dazu geführt, dass das Mediensystem auf einer digitalen Infrastruktur basiert. Ursprünglich ist mit Digitalisierung ein technischer Prozess gemeint. Dieser ist zunächst dadurch gekennzeichnet, dass die in einer Nachricht oder Botschaft enthaltene Bedeutung bzw. Information in bedeutungsfreie Daten umgewandelt wird, z. B. mithilfe der binären Ziffern 0 und 1. So lässt sich beispielsweise das Wort »heute« als Folge von binären Ziffern darstellen, wenn jeder Buchstabe des Alphabets durch binäre Ziffern verschlüsselt wird. Dabei haben binäre Ziffern den Vorteil, dass sie physikalisch leicht darstellbar sind: 1 und 0 z. B. als zwei unterschiedliche elektrische Zustände (vgl. Knaus 2016, S. 101). Aufgrund ihrer physikalischen Darstellbarkeit lassen sich die Daten technisch verarbeiten und im Ergebnis wieder so als Zeichenmuster präsentieren, z. B. als schriftlicher Text oder als Bild, dass Nutzende ihnen wieder eine Bedeutung zumessen können. Aufgrund der Verarbeitung von Daten und durch begleitende Hardware- und Software-Entwicklungen hat die zunächst technische Digitalisierung eine große Bedeutung erlangt und zu Wandlungsprozessen in vielen gesellschaftlichen Bereichen, z. B. in Beruf und Wirtschaft, geführt. Dabei ist der Begriff der Digitalisierung auf alle gesellschaftlichen Wandlungsprozesse erweitert worden, die auf der Digitaltechnik beruhen – in diesem Zusammenhang auch auf Wandlungen der Medienlandschaft bzw. des Mediensystems (vgl. Knaus 2016, S. 103). Dort hat die Digitalisierung zu einem neuen Mediatisierungsschub geführt (vgl. Krotz 2016, S. 27). In diesem Kontext sind für das Mediensystem zugleich Vernetzung, Sensorisierung, Datafizierung und Algorithmisierung wichtig geworden (vgl. Gapski 2016, S. 22; Schelhowe 2007, S. 39–74; Tulodziecki, Herzig u. Grafe 2021, S. 19). Mit der Zeit gewinnt zusätzlich das maschinelle Lernen bzw. die Künstliche Intelligenz an Bedeutung (vgl. Knaus 2017, S. 44; Tulodziecki 2020a, S. 36–42).
Vernetzung bedeutet, dass Computer bzw. Informatiksysteme zunehmend weltweit verknüpft sind und so jederzeit auf global verfügbare Daten bzw. Wissensbestände und Unterhaltungsangebote sowie weitere mediale Möglichkeiten zugegriffen werden kann. Dies ist u. a. mit der Chance verbunden, eigene Positionen und mediale Beiträge global zu verbreiten. Sensorisierung meint, dass eine wachsende Zahl elektronischer Messgeräte über Sensoren immer größere Mengen von Daten aufnehmen, z. B. im Haushalt, im Verkehr, in der sonstigen Umwelt oder am menschlichen Körper. Diese lassen sich dann zur Speicherung sowie zur Verarbeitung und Auswertung an onlinebasierte Speicher- und Serverdienste bzw. Rechnernetzwerke senden und nach der Verarbeitung medial präsentieren (vgl. Bader 2016). Dabei entsteht ein »Internet der Dinge«, in dem technische Einrichtungen, z. B. Haushaltsgeräte oder Maschinen in einer Fabrik, untereinander oder mit Menschen kommunizieren. Datafizierung bezieht sich darauf, dass immer mehr Zustände oder Lebenssituationen verschiedener Art in quantitativer Form als Daten erfasst werden und für eine Verarbeitung durch Informatiksysteme zur Verfügung stehen. Algorithmisierung beschreibt den Prozess der Strukturierung von Vorgehensweisen zur Lösung von Problemen oder Aufgaben in kleine Teilschritte, sodass sie in programmierter Form maschinell bearbeitet werden können (vgl. Gapski 2016). Im Zusammenhang der Vernetzung, Sensorisierung, Datafizierung und Algorithmisierung können zum einen Menschen mit Computern über eine medial zu gestaltende Mensch-Computer-Schnittstelle interagieren (vgl. Knaus 2017, S. 27). Zum anderen ist es möglich, dass auch Informatiksysteme ohne menschliche Eingriffe untereinander kommunizieren. Maschinelles Lernen führt zusätzlich dazu, dass Informatiksysteme nicht nur vorhandene Daten nach vorgegebenen Algorithmen verarbeiten, sondern dass Lernalgorithmen entworfen und umgesetzt werden, die – in Analogie zu menschlichem Lernen – sich selbst weiterentwickeln und damit Fähigkeiten simulieren, die sonst nur dem Menschen vorbehalten waren, und z. B. lernen, Schach zu spielen, Gegenstände oder Personen zu erkennen oder Sprache zu verstehen und zu produzieren. Dabei ist es ein Ziel von Forschungen zur Künstlichen Intelligenz (KI), möglichst bessere Leistungen zu erzielen als der Mensch – was auch in einzelnen Bereichen schon gelungen ist, z. B. beim Schachspiel oder im medizinischen Bereich bei der Erkennung von Krebszellen. Zugleich bemüht sich die KI-Forschung, immer weitere Funktionen maschinell auszuführen und immer mehr intelligente Denk- und Handlungsvollzüge zu simulieren. In Medienzusammenhängen ist besonders wichtig, dass sich mithilfe Künstlicher Intelligenz Medienbeiträge maschinell erzeugen lassen, ohne dass dies für Nutzende erkennbar ist.
All dies legt es nahe, dass schon bei der Medienerziehung und Medienbildung in der Grundschule sowohl die inhaltliche und gestalterische Vielfalt medialer Möglichkeiten als auch ökonomische Interessen und die digitale Infrastruktur der Medienlandschaft zu thematisieren sind – wobei dies in altersgerechter Form geschehen muss. Bezüglich digitaler Grundlagen kann in diesem Band allerdings auf weitergehende Darstellungen verzichtet werden, weil diese im Rahmen der vorliegenden Reihe in einem eigenen Band zur informatischen Bildung zur Sprache kommen.
1.4 Allgemeine Chancen und Risiken der Mediennutzung
Die Medienlandschaft stellt mit ihren Merkmalen eine wichtige Bedingung für Erziehung und Bildung dar. Kinder begegnen ihrer Umwelt u. a. mit ihren Bedürfnissen nach Sinneserregung und Erkundung, nach Sicherheit und Orientierung, nach Zugehörigkeit und Liebe, nach Fantasieanregung und Wertschätzung, nach Wissen und Autonomie. Sie machen so Erfahrungen und verarbeiten diese auf der Basis ihres Kenntnis- und Entwicklungsstandes. Aus der Wechselbeziehung von Erfahrungsmöglichkeiten einerseits und kindlichen Bedürfnissen sowie Verarbeitungsmöglichkeiten andererseits ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken. Für die Beantwortung der Frage, ob Chancen genutzt werden und Risiken zum Tragen kommen, ist darüber hinaus das jeweilige soziale Umfeld wichtig.
Vor diesem Hintergrund sollen zunächst einige allgemeine Chancen und Risiken der Mediennutzung in der gebotenen Kürze angesprochen werden (vgl. zu entsprechenden Forschungsergebnissen z. B. Schaumburg u. Prasse 2019, S. 52–103). Dabei richtet sich der Blick auf Aspekte, die für Erziehung und Bildung besonders bedeutsam sind: Wahrnehmung von Welt, Umgang mit Informationen, Regulierung von Emotionen, Gestaltung von sozialen Beziehungen, Formen des Lernens, Entwicklung des Denkens, Erwerb von Verhaltens- und Wertorientierungen (vgl. Tulodziecki, Herzig u. Grafe 2021, S. 24–28).
Wahrnehmung von Welt: In der Medienlandschaft stellt sich die Welt den Kindern in einer vielfältigen Zeichensprache dar, z. B. in ruhenden und bewegten Bildern, in Hörbeiträgen oder in schriftlichen Texten, im Rahmen akustischer Räume sowie in zweidimensionalen oder dreidimensionalen Darstellungen und Simulationen. Mit dem Ringen um Aufmerksamkeit geht eine Verstärkung der Sinnesreizung in optischer und akustischer Hinsicht einher. So erscheint die Welt als ein schillerndes, die Sinne und gegebenenfalls auch das Denken anregendes Gebilde mit zahlreichen Möglichkeiten der Information, der Kommunikation und der Unterhaltung – sei es bei der Rezeption medialer Botschaften, sei es beim Agieren in sozialen Netzwerken oder in virtuellen Welten. Dabei besteht die Gefahr, dass Seh- und Hörsinn überreizt werden und nur noch starke Reize Aufmerksamkeit erregen. Unter Umständen geschieht die Aufmerksamkeitslenkung dann vorwiegend durch Sinnesreizung und weniger durch bedeutsame Inhalte. Insgesamt scheint die Präsentationsform gegenüber den Inhalten immer wichtiger zu werden – im Extremfall bis zum »Verschwinden der Inhalte« hinter der Form.
Читать дальше