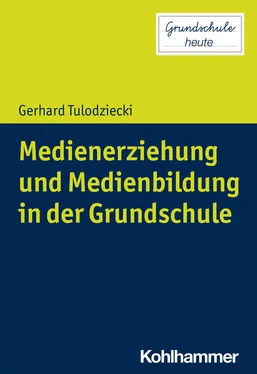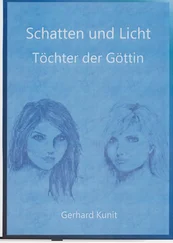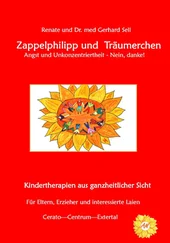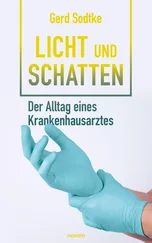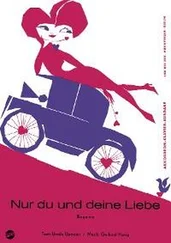Paul lebt mit seinen Eltern in einem Reihenhaus am Rande einer Großstadt. Er ist neun Jahre alt und hat eine vier Jahre ältere Schwester. Im Haushalt der Familie sind Fernsehgerät, Telefon, Smartphone, Radio, Internetzugang, Computer, Laptop, Tablet, Digitalkamera, CD- und DVD-Player, Spielkonsole, Bücher, Zeitschriften und eine Tageszeitung vorhanden. In seinem Kinderzimmer befinden sich eine Spielkonsole, ein CD-Player und Kinderbücher. Neuerdings besitzt er auch selbst ein Smartphone. Morgens lässt sich Paul in der Regel durch sein Smartphone mit seinem Lieblingston wecken. Wenn er zum Frühstück in die Küche kommt, hört die Mutter stets das Morgenmagazin im Radio. In der Küche sitzt üblicherweise schon die ältere Schwester, die beim Frühstück oft auf ihrem Smartphone nachschaut, ob ihre Freundinnen irgendwelche Nachrichten oder Bilder gesendet haben, wobei sie auf diese häufig sofort reagiert. Außerdem liegt auf dem Esstisch normalerweise die Tageszeitung, die der Vater durchgeblättert hat, bevor er zu Arbeit gegangen ist. Paul wirft meistens noch schnell einen Blick in den Sportteil der Zeitung.
Dann macht er sich auf den Schulweg. Dabei hört er des Öfteren über sein Smartphone Musik eines Audio-Streaming-Dienstes. Wenn er auf dem Schulweg Freunde trifft, unterhalten sie sich immer wieder über Sportereignisse, aktuelle Konsolenspiele oder Videos. In der Schule wird in der Regel mit herkömmlichen Hilfsmitteln wie Tafel, Kreide und Lernmaterialien gearbeitet. Manchmal lässt die Klassenlehrerin aber auch Internetrecherchen durchführen oder die Kinder an einzelnen digitalen Übungsprogrammen arbeiten. Wenn Paul nach der Schule nach Hause kommt, schaut er sich hin und wieder auf seinem Smartphone einzelne lustige Videos an, von denen er in den Pausen gehört hat. Nach dem Essen setzt er sich normalerweise an seine Hausaufgaben. Diese erledigt er meistens in seinen Schulheften. Hin und wieder muss er auch ergänzend zum Unterricht kleinere Internetrecherchen ausführen. Dazu verwendet er den Computer seiner Mutter. Während er Hausaufgaben macht, läuft im Hintergrund fast immer Musik von seiner Lieblingsband auf dem CD-Player. Bei besonderen Anlässen, z. B. bei Geburtstagen der Großeltern, nutzt er auch die Möglichkeit der Videotelefonie.
Nachmittags verabredet er sich häufig per WhatsApp mit einigen Freunden. Dabei nimmt er zunehmend den Sprachassistenten in Anspruch. Ein beliebter Treffpunkt ist der nahegelegene Spiel- oder Bolzplatz. Bei den Treffen kommt es ab und zu vor, dass er mit dem einen oder anderen Freund ein Selfie oder ein anderes Foto macht. Wenn Paul zurückkehrt, sitzt seine Schwester häufig im Wohnzimmer vor dem Fernseher und schaut sich eine Vorabendserie an. Er guckt dann lieber Videos auf dem Tablet. Da die Eltern am Abend in der Regel Fernsehfilme oder andere Sendungen anschauen, die ihn weniger interessieren, hat er sich daran gewöhnt, nach dem Abendessen auf sein Zimmer zu gehen und an seiner Spielkonsole zu spielen. In seltenen Fällen greift er auch zu einem Kinderbuch in seinem Zimmer. Vor dem Schlafengehen schaltet er üblicherweise noch einmal den CD-Player ein, um bei Hintergrundmusik einzuschlafen.
Mit Blick auf eine solche Mediennutzung lässt sich u. a. fragen, welche Formen dabei zum Tragen kommen, in welchen Nutzungsbereichen sie erfolgt und welche Merkmale das Medienangebot bzw. die Medienlandschaft aufweist. Vor diesem Hintergrund ergibt sich dann die Frage, welche Chancen und Risiken mit einer entsprechenden Mediennutzung gegebenenfalls verbunden sind.
1.2 Grundformen der Mediennutzung und Nutzungsbereiche
An dem obigen Beispiel werden verschiedene Formen der Mediennutzung von Kindern erkennbar. Als grundlegende Formen der Mediennutzung lassen sich zunächst die Rezeption und die Produktion unterscheiden. Eine rezeptive Nutzung ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder mediale Botschaften bewusst wahrnehmen – etwa wenn Paul Videos anschaut, Podcasts oder CDs hört, sich für die Sportnachrichten in der Zeitung interessiert oder in einem Kinderbuch liest. Eine produktive Mediennutzung liegt vor, wenn Kinder sich selbst in medialer Form äußern – etwa wenn sie Fotos oder Videos aufnehmen oder in der Schule Aufsätze schreiben. Streng genommen stellen auch schon eigene WhatsApp-Nachrichten in einem Chat oder die Auswahl einer Internetseite im Rahmen einer Recherche eine selbsttätige Aktion in medialer Form dar. Allerdings werden die letztgenannten Formen häufig nicht der produktiven Mediennutzung zugeordnet, sondern eher als interaktive Mediennutzung bezeichnet. Dabei kann die Interaktion auf den personalen Austausch (wie beim WhatsApp-Chat) oder auf ein Informatiksystem (wie bei der Internetrecherche) bezogen sein. Dementsprechend kann man auch von interaktiv-austauschbezogenen oder interaktiv-eingreifenden Nutzungsformen sprechen. Interaktiv-austauschbezogene Formen liegen – außer beim WhatsApp-Chat – beim Telefonieren mit oder ohne Video oder beim Agieren in sozialen Netzwerken (social networks) vor. Als interaktiv-eingreifende Nutzung ist z. B. für Paul und viele andere Kinder das computerbasierte Spiel bedeutsam. Daneben kann man noch interaktiv-partizipative Formen (etwa das Agieren in Blogs oder Wikis) und interaktiv-steuerungsorientierte Nutzungsformen (etwa bei smart home-Entwicklungen) nennen, die allerdings für Kinder bisher weniger wichtig sind. Insgesamt kommen die genannten Grundformen – Rezeption, Produktion und Interaktion mit ihren Varianten – in verschiedenen Nutzungsbereichen zur Geltung.
Im eingangs skizzierten Tagesablauf von Paul dient die Medienverwendung beispielsweise dazu, eine angenehme Stimmung zu erzeugen (z. B. durch Musik im Hintergrund), sich zu unterhalten (z. B. durch das Anschauen eines Videos), zu spielen (z. B. durch Nutzung eines Konsolenspiels), sich zu informieren (z. B. bei Internetrecherchen), etwas zu lernen (z. B. bei der Bearbeitung eines Übungsprogramms), mit anderen zu kommunizieren (z. B. durch WhatsApp-Nachrichten) oder sich selbst oder etwas anderes darzustellen (z. B. durch ein Foto von einer Aktion auf dem Spiel- oder Bolzplatz). Darüber hinaus können schon Kinder erfahren, dass sich Medien zur Analyse, zur Simulation, zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen sowie zur Steuerung und Kontrolle verwenden lassen. Beispiele dafür sind: die Aufzeichnung eines Rollenspiels mit anschließender Analyse des praktizierten Kommunikationsverhaltens, die Nutzung eines Spiels, in dem die Besiedlung eines Gebietes simuliert wird, der Verkauf von nicht mehr benötigtem Spielzeug mithilfe der Eltern über eine Verkaufsplattform, die Steuerung der Heizung und die Kontrolle des Bewegungsverhaltens mithilfe eines Smartphones. Dabei können sich die Nutzungsbereiche überschneiden. Beispielsweise mag das abendliche Konsolenspiel von Paul neben dem Spielen auch der Unterhaltung (im Sinne der Vermeidung von Langeweile) und der Information darüber dienen, welche Spiele zurzeit bei den Freunden »in« sind.
Für alle Nutzungsbereiche haben sich die Möglichkeiten durch die zunehmende Durchdringung des Alltags mit Medien erheblich erweitert. Dabei stellt die Medienlandschaft den allgemeinen Raum für die Mediennutzung dar. Deshalb liegt ein kurzer Blick auf Merkmale des Medienangebots bzw. auf die Medienlandschaft nahe.
1.3 Merkmale der Medienlandschaft
Als Merkmale der Medienlandschaft lassen sich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – nennen: Vielzahl medialer Möglichkeiten und Medienkonvergenz, umfangreiche Inhaltspalette, vielfältige Gestaltungsoptionen, ökonomische Orientierung, Digitalisierung und digitale Infrastruktur. Diese Merkmale werden nachstehend in aller Kürze erläutert. Selbst wenn Kinder einzelne Merkmale kaum oder anders, vielleicht auch noch gar nicht direkt wahrnehmen, ist es doch wichtig, den »Raum« im Blick zu behalten, in dem sich erzieherische oder bildungsbezogene Maßnahmen letztlich bewähren müssen.
Читать дальше