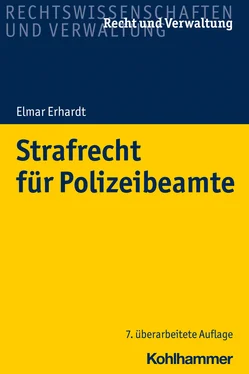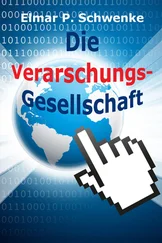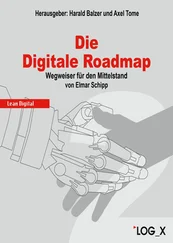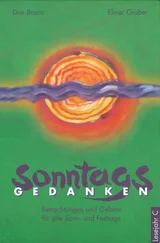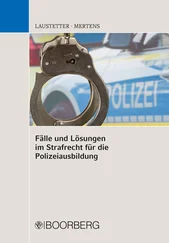46aDie einzelnen Varianten des „Kausalitäts-Falles“ zeigen deutlich die Schwäche der Äquivalenztheorieauf, denn alle dort genannten Abwandlungen sind nicht wegdenkbare Bedingungen des jeweils eingetretenen Erfolges: a) Hätte A. nicht geschossen, wäre B. nicht verletzt worden und letztlich bei dem Unfall nicht ums Leben gekommen. b) Ohne Verletzung wäre B. nicht operiert worden und dann auch nicht wegen eines ärztlichen Kunstfehlers (z. B. Narkosefehler) verstorben. c) Dann hätte er auch keine infizierte Blutkonserve bekommen und wäre somit auch nicht daran gestorben. d) Gleiches gilt für die Wundinfektion und e) für das Verbrennen in der Klinik, denn ohne die Schussabgabe des A. wäre B. niemals in das Krankenhaus gekommen.
Trotz der genannten „Schwäche“ der Bedingungstheorie, die scheinbar in ihrer uferlosen Weite liegt, hält die Rspr. nach wie vor an ihr fest. Auch wenn die Adäquanz- und Relevanztheorie eine bestechende Logik für sich beanspruchen können, so hat doch die alte Äquivalenztheorie ein entscheidendes Argument für sich: Bei der Frage der Verursachung eines bestimmten Erfolges, also der Kausalität, geht es um das ewige naturwissenschaftliche Phänomen von Ursache und Wirkung („Was war zuerst da, die Henne oder das Ei?“) . Eine erste Annäherung bzw. Filterung dieser Frage kann nur durch die Bedingungstheorie erfolgen. Die eigentliche Zurechnungleistet die Lehre von der objektiven Zurechnungschon im objektiven Tatbestand, die Rechtsprechungdagegen im Falle des Vorsatzdelikts bei der Frage nach der Vorstellung über den Kausalverlauf: Ist ein eventueller Irrtum über den Kausalverlauf wesentlich oder unwesentlich? Beim Fahrlässigkeitsdelikt wird die Zurechnung über das Kriterium der „objektiven Vorhersehbarkeit“ geklärt. Für die Justizpraxisund die Polizeiist die in st. Rspr. vertretene Bedingungstheorie maßgebend. Dabei bleibt festzuhalten, dass die von der Rspr. vorgenommene Einordnung von Zurechnungsproblemen auf der Ebene des subjektiven Tatbestandes im Wesentlichen zu gleichen Ergebnissen kommt. Eine entsprechende Lösungsmethode zeigt der folgende Übungsfall.
47Übungsfall 9: „Bluter-Fall“ 7
Der beamtete Lehrer L. veranstaltet am Schulwandertag mit seiner Klasse eine Wanderung im Hochschwarzwald. Der Schüler S. ist schon mehrfach als unfolgsam aufgefallen. Als S. wieder eine Dummheit macht, reißt dem entnervten L. die Geduld. L., der sonst kein Anhänger der Prügelstrafe ist, versetzt dem S. eine kräftige Ohrfeige. Ein scharfkantiger Ring an seiner Hand verursacht eine blutende Platzwunde. Da S. an der seltenen Bluterkrankheit (Hämophilie) leidet, bei der der Körper keinen Blutgerinnungsstoff produziert, kommt die Blutung nicht zum Stillstand. Bis endlich ärztliche Hilfe in das unwegsame Gelände geholt werden kann, ist S. gestorben. L., der von der seltenen Krankheit des S. nichts gewusst hat, ist über die Folgen seiner Ohrfeige entsetzt.
Hat L. sich strafbar gemacht?
Lösungsskizze
Zur Strafbarkeit des L.
1. § 212 I (Totschlag)?
Tatbestandsmäßigkeit: Objektiv:
a) Handlung= Ohrfeige
b) tatbestandlicher Erfolg= Tod des S.
c) Kausalität :Ist die Handlung (Ohrfeige) für den Erfolgseintritt (Tod des S.) kausal?
Nach der Äquivalenztheorie(Bedingungstheorie) kann die Ohrfeige nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod des S. in seiner konkreten Gestalt (= Tod durch Verbluten) entfiele. Die Ohrfeige ist also conditio sine qua non (eine nicht hinwegdenkbare Bedingung)für den Erfolgseintritt, somit kausal. Weitere Voraussetzungen prüft die Bedingungstheorie (Rspr.) im objektiven Tatbestand nicht.
Nach der Adäquanztheoriewäre die Ohrfeige nicht adäquat kausal, da es außerhalb jeder Lebenserfahrung liegt, dass durch eine schlichte Ohrfeige der Tod eines Menschen verursacht wird.
Nach der Relevanztheoriewäre die Ohrfeige zwar kausal, aber nicht objektiv zurechenbar, denn dieser atypische, irreguläre Kausalverlauf wäre schon objektiv nicht vorhersehbar.
Nach der Adäquanztheorie und der Relevanztheorie wäre die Prüfung des § 212 I damit beendet.
Tatbestandsmäßigkeit: Subjektiv:
Nur die Äquivalenztheorie kommt zur Prüfung des subjektiven Tatbestandes, muss aber im vorliegenden Bluterfall den Vorsatzverneinen mangels Wissen und Wollender Tatbestandsverwirklichung. Denn das Vorliegen der höchst seltenen Bluterkrankheit liegt „völlig außerhalb dessen, was nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung noch in Rechnung zu stellen ist“. 8
L. hat sich also nach keiner Meinung gem. § 212 I strafbar gemacht.
2. § 222 (Fahrlässige Tötung)?
Der Aufbau des Fahrlässigkeitsdelikts wird später ausführlich besprochen. Nur soviel sei vorweggenommen: Nach allen Meinungen gehört bereits zum objektiven Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts neben der objektiven Pflichtwidrigkeit auch die objektive Vorhersehbarkeit. Diese ist hier – wie bereits gezeigt – zu verneinen. L. hat sich also auch nicht gem. § 222 strafbar gemacht.
3. § 223 I (Einfache Körperverletzung )?
§ 223 ist problemlos zu bejahen. Es ist allenfalls darauf zu achten, dass es heute für einen Lehrer kein anerkanntes „Züchtigungsrecht“als Rechtfertigungsgrund mehr gibt.
4. § 224 (Gefährliche Körperverletzung )?
Zwar käme der scharfkantige Ring objektivaufgrund seiner konkreten Anwendungsart (als Schlaginstrument) als anderes gefährliches Werkzeug (Nr. 2)in Betracht, doch erscheint die Unterstellung eines entsprechenden Vorsatzesdes L. eher zweifelhaft.
5. § 227 (Körperverletzung mit Todesfolge)?
§ 227 ist ein sog. erfolgsqualifiziertes Delikt(vgl. § 18), das aus einer vorsätzlichen Körperverletzung und einer dadurch fahrlässig verursachten Todesfolge zusammengesetzt ist. § 227 scheidet hier aus, da zwar die vorsätzliche Körperverletzung, nicht aber die fahrlässige Tötung zu bejahen ist (s. oben Ziff. 2).
6. § 340 (Körperverletzung im Amt)?
Auch diese Vorschrift ist erfüllt: L. ist als beamteter Lehrer Beamter und hat somit als „Amtsträger“ gehandelt und „während der Ausübung seines Dienstes“ und „in Beziehung auf seinen Dienst“ eine Körperverletzung begangen.
Ergebnis: L. hat sich wegen einfacher Körperverletzung gem. § 223 I und wegen Körperverletzung im Amt gem. § 340 strafbar gemacht.
48 a) Die Grundregel..Das Problem der atypischen, irregulären Kausalverläufe verlagert die Rspr. in den Vorsatzbereich, greift dort aber bei der „subjektiven“ Zurechnung auf die Maßstäbe der Relevanztheorie und damit auf die Kriterien der objektiven Zurechenbarkeit zurück: allgemeine Lebenserfahrung, Vorhersehbarkeit, Risikoverwirklichung bei atypischen Geschehensabläufen.
49 b) „Hypothetische“ Kausalverläufe..Bei Anwendung der c.s.q.n.-Formel darf nur die konkrete Handlung hinweggedacht werden, keinesfalls darf eine hypothetische Ersatz- oder Reserveursache hinzugedacht werden. Es ist nicht zulässig, Ersatzursachen hinzuzudenken, die anstelle der wegzudenkenden Handlung wirksam geworden wären, also auch den Erfolg herbeigeführt hätten. So darf man z. B. im „Dudley and Stephans-Fall“ (Übungsfall 5) nicht hinzudenken, dass J. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sowieso kurz darauf an Hunger und Durst gestorben wäre, denn das wäre eine verbotene hypothetische Ersatzursache. Weiteres Beispiel: A. erschießt B. kurz bevor dieser ein Flugzeug besteigt. Kurz darauf stürzt das Flugzeug ab, und B. wäre dabei umgekommen (hypothetische Kausalität).
Читать дальше