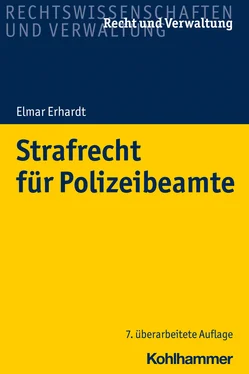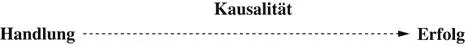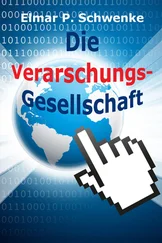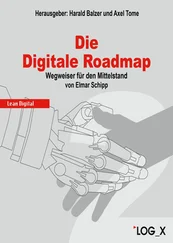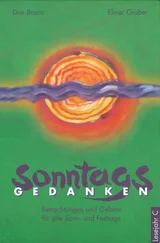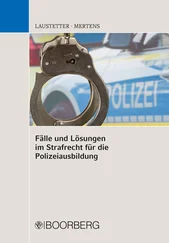2.Abgrenzung Handlung/Nichthandlung:
41In Prüfungsfällen ist die „Handlungsqualität“ in aller Regel nicht problematisch. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen kann einmal fraglich sein, ob überhaupt eine Handlung (im strafrechtlichen Sinne) vorliegt. Nach allen Handlungslehren ist Voraussetzung für das Vorliegen einer Handlung, dass ein „vom Willen getragenes (beherrschbares) menschliches Verhalten“gegeben ist. Nach diesem Kriterium als Minimalvoraussetzung ist die Abgrenzung zu sog. Nichthandlungenvorzunehmen:
41aa) KeineHandlung liegt bei reinen Reflexbewegungenvor, wie z. B. bei Krampfanfällen, bei Zucken und Stoßen bei epileptischen Anfällen, Bewegungen im Schlaf oder in Bewusstlosigkeit. Reflexbewegungen sind willensunabhängigeBewegungen und damit keine Handlungen im strafrechtlichen Sinn.
b) Gleiches gilt für rein instinktive Schreckreaktionen, die der Willensbeherrschung entzogen sind. 2
c) Beherrschbare Spontanreaktionen , Affekt - und Kurzschlusshandlung ensind Handlungen im strafrechtlichen Sinne, da sie aus einer bestehenden Handlungsbereitschaft hervorgehen, also noch vom Willen getragenes Verhalten sind. Auch sog. automatisierte Verhaltensmuster(z. B. Kuppeln und Schalten beim Autofahren) laufen zwar im Unterbewusstsein ab, sind aber vom Willen beherrschbar und somit strafrechtliche Handlungen.
d) Bei Verhalten im Zustand der Hypnosenimmt die h. M. eine Nichthandlung an, weil das Verhalten der Willenskontrolle entzogen sei. 3
e) Eine typische Nichthandlung liegt vor, wenn ein Verhalten durch äußere willensausschließendeGewalt unmittelbar erzwungen wird, „vis absoluta “genannt.
Beispiel:
A. stößt den B. die Treppe hinunter. Unten stößt B. im Fallen eine wertvolle Vase um, die dabei zu Bruch geht.
Hier liegt keine Sachbeschädigung durch B. vor, da sein Verhalten keine Handlung im strafrechtlichen Sinne darstellt, weil das Umstoßen der Vase nicht von seinem Willen gesteuert wurde, vielmehr durch absolute Gewalt erzwungen wurde.
Beispiel:
B. wird versehentlich gegen eine Fensterscheibe gedrückt, welche zerbricht. – Gewaltsames „Handführen“ bei der Unterschrift.
f) Im Gegensatz dazu schließt die sog. vis compulsivadie Handlungsqualität nicht aus. Diese Gewalt wirkt nur willensbeugend. An vis compulsiva ist immer zu denken, wenn jemand unter fremdem Willenseinfluss oder unter Druck handelt.
Beispiel:
Die Gangster A. und B. haben das Kind der Bankangestellten C. entführt. Sie drohen C., das Kind zu töten, wenn C. nicht den Tresor der Bank für sie ausräumt.
Eine Handlung der C. ist zu bejahen, weil die Erpressung lediglich willensbeugend wirkt. Die Lösung des Problems ist also nicht beim Handlungsbegriff, sondern bei der Rechtswidrigkeit oder Schuld zu suchen. Bei vis compulsiva ist an §§ 34, 35 zu denken.
II.Die Kausalität
1.Das Problem
42Bei den meisten Straftatbeständen des BT des StGB ist neben den dort als strafwürdig umschriebenen Verhaltensweisen der Eintritt eines bestimmten Erfolges erforderlich. So kann § 212 nur vollendet sein, wenn als tatbestandlicher Erfolg der Tod eines Menschen eingetreten ist. Weitere Beispiele sind §§ 218 (Abtötung der Leibesfrucht), 222 (Tod eines Menschen), 223 (Verletzung eines Menschen), 263 (Schaden beim Opfer) usw. Man bezeichnet solche Tatbestände als Erfolgsdelikte. Im Gegensatz dazu stehen die sog. schlichten Tätigkeitsdelikte. Bei diesen genügt zur Verwirklichung des Tatbestandes schon die Begehung der im Gesetz umschriebenen Tätigkeit: z. B. „falsch aussagen“ bei §§ 153 ff. (Aussagedelikte wie uneidliche Falschaussage oder Meineid) oder „betrunken Autofahren“ bei § 316 (Trunkenheit im Verkehr).
Bei den Erfolgsdelikten muss zwischen der Handlung und dem eingetretenen Erfolg ein bestimmter Zusammenhang, nämlich ein Ursachenzusammenhang (Kausalzusammenhang )bestehen, der den Erfolg als das Werk des Handelnden erscheinen lässt. Hier stellt sich die Frage der Kausalität. Die Handlung muss für den Erfolg kausalgeworden sein.
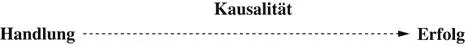
In den meisten Fällen ist die Frage der Kausalität völlig unproblematisch: z. B. A. schießt vorsätzlich auf B. und tötet ihn. Hier ist offensichtlich, dass der Tod des B. ein Werk des A. ist, also von A. verursacht wurde. Der Schuss ist kausal für den Tod des B. In anderen Fällen aber kann die Kausalität fraglich sein:
43Übungsfall 8: „Kausalitäts-Fall“
A. schießt mit Tötungsvorsatz auf B. Dieser erleidet aber nur einen harmlosen Streifschuss. Dennoch kommt B. zu Tode, weil
a) der Krankenwagen, mit dem B. zur ärztlichen Versorgung der Schusswunde in eine Klinik verbracht werden soll, unterwegs einen Unfall hat, und B. an den Unfallfolgen verstirbt;
b) der behandelnde Arzt einen Kunstfehler begeht, und B. daran stirbt;
c) B. eine mit HIV verseuchte Blutkonserve erhält und Jahre später an AIDS stirbt;
d) weil eine Wundinfektion eintritt;
e) weil im Krankenhaus ein Brand ausbricht.
Aufgabe:Prüfen Sie, ob der Schuss des A. den jeweils eingetretenen Tod des B. kausal verursacht hat!
44 a) Die Äquivalenztheorie (Bedingungstheorie)..Diese Theorie wird bis in die jüngste Zeit von der Rspr. vertreten und stellt nach wie vor die ganz h. M. dar. 4Sie prüft die Kausalität nach der sog. conditio sine qua non-Formel, 5wonach jede Bedingung (Handlung) dann kausal ist, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Alle Bedingungen in diesem Sinne sind absolut gleichwertig. Damit geht die Bedingungstheorie von der kausalen Gleichwertigkeit(Äquivalenz) aller Faktoren, die einen Erfolg bewirkt haben, aus. Insoweit kann nicht zwischen nahen und fernen oder zwischen typischen und atypischen oder rein zufälligen Faktoren unterschieden werden. Hierin zeigt sich die Schwäche der Äquivalenztheorie, die in ihrer uferlosen Weite liegt, weil sie nicht in der Lage ist, ganz entfernt liegende Ursachen auszuschließen. So ist die Zeugung eines Kindes, das 30 Jahre später einen Menschen ermordet, eine nicht hinweg denkbare (kausale) Bedingung für den Tod dieses Menschen.
45 b) Die Adäquanztheorie..Sie baut auf der Äquivalenztheorie auf, scheidet aber alle Ursachen aus, bei denen es nicht vorhersehbar und nach der allgemeinen Lebenserfahrung völlig unwahrscheinlich ist, dass sie zu einem Erfolg dieser Art führen. Nach ihr wird die Kausalität verneint, wenn der Erfolg auf einem regelwidrigen, atypischen Kausalverlauf, d. h. auf einer ganz ungewöhnlichen und unwahrscheinlichen Verkettung von Umständen beruht, mit denen nach der Erfahrung des täglichen Lebens nicht zu rechnen war.
46 c) Die Relevanztheorie..Sie ist im Ergebnis der Adäquanztheorie weitgehend gleich, unterscheidet jedoch dogmatisch streng zwischen der Verursachungsfrage (Kausalität) und der objektiven Zurechnungdes Erfolges. Bei der Feststellung der Kausalität geht sie von der Äquivalenztheorie aus. Die Relevanztheorie versucht jedoch, die uferlose Weite der Bedingungstheorie schon im objektiven Tatbestand einzuschränken (die Bedingungstheorie dagegen erst im subjektiven Tatbestand). Sie sagt, dass aus der kausalen Gleichwertigkeit (Äquivalenz) nicht auch ihre rechtliche Gleichwertigkeit folge. Die Kausalbedingungen müssen im Rahmen der Zurechnungsfrage auf ihre strafrechtliche Relevanz überprüft werden. Wichtigstes Kriterium der objektiven Zurechnung ist die objektive Vorhersehbarkeit. Danach entfällt bei regelwidrigen, atypischen Kausalverläufen die objektive Zurechnung, weil sie nicht objektiv voraussehbar sind. Die moderne „Lehre von der objektiven Zurechnung “gilt heute in der Rechtswissenschaft als h. M. 6Nach ihr kommt der „objektiven Zurechnung“ die Aufgabe zu, die Weite der Äquivalenztheorie bereits im objektiven Tatbestand durch normative Kriterien einzugrenzen.
Читать дальше