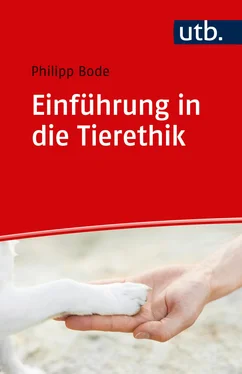Einig sind sich Tierrechtspositionen allerdings in ihrer Kritik, Tierschutzethiken ginge es lediglich um die Behandlung von Tieren, aber nicht um ihren Gebrauch. Dabei sei der Gebrauch von Tieren das eigentliche und tiefer liegende Problem, dem sich die Tierethik zuzuwenden habe.
Die stärkste Ausprägung der Tierrechtsbewegung ist der sog. Abolitionismus (von engl. abolition, Abschaffung). Er verlangt unter Verweis auf die unhintergehbaren moralischen Rechte der Tiere (a) die sofortige Abschaffung aller Tierhaltung und allen Tiergebrauchs zu menschlichen Zwecken, sowie (b) die vollständige Abschaffung jeglicher Besitzansprüche auf Tiere. Abolitionisten sehen zwischen den moralischen Rechten von Mensch und Tier keinen Unterschied und keine Graduierung. Es gibt für den Abolitionismus schlichtweg keine Rechtfertigungsmöglichkeit, Tieren zum Nutzen des Menschen Leid zuzufügen bzw. sie zu töten. Prominente Vertreter einer abolitionistischen Tierrechtstheorie sind der US-amerikanische Philosoph TOM REGAN und sein Landmann, der Rechtswissenschaftler GARY L. FRANCIONE.
Die Anerkennung moralischer Grundrechte für Tiere muss allerdings nicht zwingend zum Abolitionismus führen, also zur gänzlichen Einstellung des Gebrauchs von Tieren (vgl. etwa Miligan 2015, Kap. 7). Zumindest argumentiert so der britische Philosoph ALASDAIR COCHRANE. Jede Tierbefreiungsbewegung fußt auf der Annahme, Nutztiere seien unfrei. Und genau diese Annahme ist in COCHRANES Augen falsch. Um nämlich unfrei sein zu können müssten Tiere ein Interesse an Freiheit haben. Und ein Interesse an Freiheit können nur Wesen aufweisen, die ein Interesse an freien Entscheidungen und Selbstständigkeit haben. Das ist der Grund, weshalb wir es auch dann für falsch halten, an Menschen zu forschen, wenn diese Versuche zwar schmerz- und folgenfrei sind, aber ohne Zustimmung erfolgen, also ohne freiwilliges Einverständnis. Tiere sind aber keine selbstbestimmten Wesen, folglich können sie auch nicht frei oder unfrei sein (vgl. Cochrane 2012, 72–76).
COCHRANE, das sei sofort ergänzt, erkennt Tieren zweifelsfreie Rechte auf Leben und Unversehrtheit zu. Nichts darf demnach mit Tieren geschehen, was ihnen Leid zufügt oder ihr Leben beendet. Das ist allerdings nicht der Fall, weil Tiere andernfalls unfrei wären, sondern weil der leidvolle Gebrauch gegen ihre Grundrechte verstößt. Es verbleiben für COCHRANE also durchaus legitime Praktiken des Tiergebrauchs, nämlich diejenigen, die nicht gegen moralische Grundrechte der Tiere verstoßen. Beispiel Tierversuch: Immer dann, wenn ein Tier (a) nicht aus einem gewohnten Habitat entfernt wird, (b) vor und während des Versuchs kein Leid verspürt und (c) auch nach dem Versuch keinerlei Schäden verbleiben, immer dann ist der Gebrauch des Tieres moralisch in Ordnung. Dezent weist COCHRANE darauf, dass wir etwa bei der Erforschung der Verhaltensweisen von Kleinkindern oder der kognitiven Fähigkeiten von Dementen ganz ähnlich vorgehen. Diese Menschen wissen zumeist gar nicht, dass sie Teil eines wissenschaftlichen Versuchs sind. Es wird ihnen aber vor und nach dem Versuch sowie während des Versuchs keinerlei Leid verursacht, also gehen für uns solche Versuche in Ordnung. Ähnliche (wenige) Fälle des moralisch legitimen Tiergebrauchs ergeben sich in der Landwirtschaft oder im Haustierbereich (vgl. Cochrane 2012, Kap. 5–8).
2.2.3Reformismus
Eine Argumentationslinie, die sich zwischen die Tierschutzethik und den Abolitionismus stellt, wird heute Reformismus (manchmal auch Meliorismus, von lat. meliorare, verbessern) genannt. Sie geht über die traditionelle Tierschutzethik insofern hinaus, als sie nicht auf dem Stand einer ‚lediglich‘ (wenn auch stark) verbesserten Lebensbedingung von Nutztieren stehen bleiben möchte, sondern durchaus das abolitionistische Ziel einer vollständigen Abschaffung aller Nutztierhaltung anstrebt. Sie gedenkt dies allerdings schrittweise zu tun, durch eine sukzessive Anpassung der rechtlichen Bestimmungen durch jeweils kleine Reformen.
Der Reformismus impliziert also einen kausalen Zusammenhang zwischen schrittweisen rechtlichen Reformen und der finalen Abschaffung aller tierlichen Nutzhaltung unter Zuerkennung von Rechten. Als Kernargument dient dem Reformismus dabei die Annahme, dass radikale ‚Ad-hoc-Umstellungen‘, sei es bei der Ernährung oder im Tierversuch, schlichtweg unrealistisch seien (vgl. Newkirk 1992, 43–45) und damit ein von Beginn an notwendig zu verfehlendes Ziel darstellten.
Überhaupt sehen viele Reformisten zwischen der Forderung nach Tierrechten und dem Vorgehen des Reformismus keinerlei Diskrepanz, das gemeinsame Ziel sei doch dasselbe, allein der programmatische Weg dorthin unterscheide sich, mehr noch: Der Versuch, die abolitionistische Tierrechtsbewegung vom Reformismus argumentativ zu trennen, sei vielmehr artifiziell.
Den Reformismus zeichnen bestimmte Charakteristika aus, etwa die Überzeugung, dass Tierschutz nicht lediglich die Minimierung von Schmerz und Leid bzw. eine ‚humane‘ oder ‚artgerechte‘ Haltung impliziere, sondern auf lange Sicht tatsächlich die Einstellung aller Tiernutzung in der Massentierhaltung oder im Tierversuch. Da Reformisten in aller Regel der Ansicht sind, dass abolitionistische Tierrechtsbefürworter keine plausible Agenda zur Erreichung des Ziels anzubieten haben, bieten sie selbst als Argument den kausalen Zusammenhang zwischen schrittweisen Verbesserungen in der Nutztierhaltung an. Eine zeitlich begrenzte Instrumentalisierung von Tieren zu menschlichen Zwecken müsse also hingenommen werden, um das langfristige Ziel erreichen zu können.
Reformisten können diesen ‚langen Weg‘ unterschiedlich gestalten. Ich möchte als Beispiel den österreichischen Tierschützer MARTIN BALLUCH wählen (vgl. VGT 1, VGT 2). Dieser vertritt die Ansicht, dass der Abolitionismus den Umstand verkennt, dass rationale Argumente in aller Regel keinen Einfluss auf das Verhalten von Menschen nehmen. Wir wissen ja vermutlich alle um die Umstände der Massentierhaltung und der tierlichen Lebensmittelproduktion und kaufen (zumindest die meisten von uns) dennoch Fleisch, Milch und Eier im Supermarkt.
Eine solche Diskrepanz zwischen Wissen und Handlung ist für den Reformisten dadurch zu erklären, dass in speziesistischen Gesellschaften wie der unsrigen der Aufwand für eine vegane oder auch vegetarische Lebensweise um ein Vielfaches höher ist, als einfach mit dem Strom zu schwimmen. Und dieser Mehraufwand an Energie wird, zumindest aus der Gesellschaft heraus, nirgends honoriert oder gespiegelt. Es gibt keine Tiere, die sich bei uns bedanken, es gibt keinen erkennbaren Effekt im Supermarkt. Die Regale bleiben zunächst weiter voll von tierischen Produkten und, womöglich das Schwierigste, der Aufwand wird in aller Regel mit der Zeit nicht abnehmen, es ist (zumindest heutzutage) ein permanenter Energieaufwand nötig, um vegan oder vegetarisch zu leben.
Unter diesen Umständen, so BALLUCH, ist der häufige Effekt zu beobachten, dass die Bereitschaft zu einem solchen Energieaufwand mit der Zeit sinkt und sich die Menschen von ihrer veganen oder vegetarischen Lebensweise wieder abwenden, weil ihre Kraft für andere Lebenssituationen gebraucht wird. Das ist ja auch problemlos möglich, denn die Supermarktregale sind, wie erwähnt, weiterhin voll von tierischen Produkten.
Es sei demnach also ein Irrglaube der abolitionistischen Tierrechtsbefürworter, davon auszugehen, eine philosophische Überzeugungsarbeit mittels rationaler Argumente könne Menschen von der Falschheit des Konsums tierischer Produkte überzeugen und eine fundamentale Umordnung des Mensch-Tier-Verhältnisses zur Folge haben, gleichsam von unten nach oben. Der Weg führe vielmehr von oben nach unten. In kleinen Schritten müssten den Menschen Zugänge zu tierischen Produkten abgeschnitten werden, damit der Nichtkonsum tierlicher Produkte sich im Verhalten niederschlägt.
Читать дальше