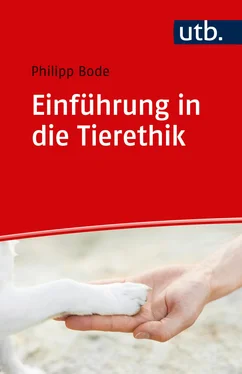Die vorliegende Einführung versteht sich als systematisch oder, um diesen etwas unattraktiven Begriff nochmal zu gebrauchen: theoretisch. Sie möchte einen Überblick über die Moraltheorien geben, die sich in den vergangenen 50 Jahren der Tierethik angenommen haben. Diese Moraltheorien stehen vor allen anwendungsorientierten Fragen. Wenn wir zu den dringlichen Problemen unseres Umgangs mit Tieren fundiert Stellung beziehen wollen, und das sollten wir fraglos tun, dann müssen wir unsere Position begründen können. Begründen können wir sie aber nur, wenn uns eine Basis für diese Begründung zur Verfügung steht, eine theoretische und begriffliche Basis, damit unsere Argumente widerspruchsfrei und stabil werden. Hierfür eine Anleitung an die Hand zu geben, ist das Anliegen dieser Einführung.
Die Tierethik hat sich in den letzten Jahren im akademischen Betrieb etablieren können (vgl. Ferrati/Petrus 2015; Böhnert/Köchy/Wunsch 2016–2017; Grimm/Wild 2016). Gegenwärtig drängen nahezu im Wochentakt neue Arbeiten zu den verschiedensten tierethischen Fragestellungen auf den Markt. Hier einen Überblick zu behalten, ist kaum noch möglich. 1Daher verstehe ich dieses Buch als Vorschlag für ein grundsätzliches Raster tierethischer Positionen. Dieses Raster ist notwendig vorläufig, wiewohl ich glaube, dass es die Basis tierethischer Debatten gut darzustellen vermag. Zweifellos werden neue, originäre Positionen entwickelt werden, die eine Reformulierung dieses Rasters früher oder später erforderlich machen, doch für den Moment mag es als Orientierung dienen.
Das (zu begrüßende) Überangebot an tierethischen Beiträgen zwingt mich zu einer Begrenzung der hier vorzustellenden Argumentationen. Wiewohl meine Auswahl natürlich subjektiv bleibt, scheinen mir die vorgestellten Autor*innen eine sinnvolle Mixtur aus ‚klassischen‘ tierethischen Texten und solchen neueren Datums zu sein. Kenner der Materie werden trotzdem manche Autorin oder manchen Autor vermissen. Das lässt sich nicht vermeiden. Insofern bleibt die folgende Übersicht meine Auswahl, obgleich mir die Häufigkeit der Zitationen und manches Mal auch die Originalität der Argumente die Auswahl zu rechtfertigen scheint.
Ebenso fallen die Darstellungen unterschiedlich umfangreich aus. Manche Argumentationsstrategien benötigen eine ausführlichere Darstellung als andere, manche sind komplexer als andere, manche lassen sich auch nur einfach besser zusammenfassen. Hier spiegelt sich also keine eigene Bewertung dieser Positionen wieder.
Ich möchte in einem ersten Schritt aufzeigen, wie wir die Tierethik grundsätzlich strukturieren können. Anschließend gebe ich einen groben Überblick über die philosophischen Begriffe, die uns durch das Buch hindurch begleiten werden. Alsdann erfolgt der eigentliche Akt, die Darstellung der sich im Raster befindlichen Argumentationsstrategien. Ich habe mir dabei gestattet, jede dieser Strategien, die zugleich auch als allgemeine ethische Einführung in die jeweilige Moraltheorie gelesen werden können, an einen bestimmten Namen zu knüpfen. Damit ist nicht ausgesagt, dass nur diese Autorinnen oder diese Autoren eine solche Position vertreten. Ich versuche auf möglichst viele weitere zu verweisen, derer sich Leser*innen dann im Selbststudium annehmen können.
Was ich in diesem Buch nicht behandeln werde, sind historische und kulturelle Exkurse sowie theologische Positionen. Ebenfalls unerwähnt lasse ich naturalistische Argumente in der Tierethik, also Argumente, die unseren Tiergebrauch mit Verweis auf menschliche Kulturleistungen, ‚die Evolution‘, ‚Arterhaltung‘, ‚Nahrungsketten‘ oder das Verhalten von Tieren untereinander zu rechtfertigen versuchen. Diese Argumente laufen allesamt ins Leere und finden daher keine Berücksichtigung (vgl. Bode 2017).
_______________
1Einen sehr hilfreichen Versuch stellen allerdings die Buchbesprechungen der Zeitschrift TIERethik dar: www.tierethik.net(Zugriff: 17. 07. 2017). Ebenfalls empfehlenswert ist folgende Übersicht über tierethische Publikationen: http://www.tier-im-fokus.ch/info-material/literatur_und_links/tierrechte#zwischentitel_a06(Zugriff: 17. 07. 2017).
2.Grundpositionen der Tierethik
2.1Positionen theoretischer Tierethiken
Mit den theoretischen Elementen der Tierethik sind jene gemeint, die für unseren tatsächlichen Umgang mit Tieren den systematischen theoretischen Unterbau ausformulieren. Sie befassen sich in der Hauptsache mit vier Fragen: Welche Dinge auf dieser Welt sind überhaupt moralisch von Belang? (→ Kap. 2.1.2, S. 20) Welche Eigenschaften muss ein Lebewesen aufweisen, um moralische Berücksichtigung zu verdienen? (→ Kap. 2.1.3, S. 22) In welcher Form kann die Aufnahme in die moralische Gemeinschaft vorgenommen werden? (→ Kap. 2.1.4, S. 23) Und schließlich: Wie lassen sich menschliche und tierliche Belange moralisch gewichten? (→ Kap. 2.1.5, S. 25)
Dies sind die Fragen, die diese Einführung prägen, an ihnen orientiere ich mich in der Folge. Die in Kap. 2.2, S. 27vorgestellten Positionen praktischer Tierethiken befassen sich mit den konkreten gesetzlichen Handlungsanleitungen oder Handlungsforderungen, die aus einer Theorie folgen. Sie dienen in dieser Einführung aber zuvorderst der Vollständigkeit und werden nur vereinzelt wieder aufgegriffen. Praktische Aspekte werden insbesondere dann bedeutsam, wenn sich die Tierethik im Detail den Anwendungsfragen zuwendet (Massentierhaltung, Tierversuche, Tiere zu Forschungs- oder Unterhaltungszwecken etc.). Nicht jede Tierethik bietet allerdings ausgearbeitete Konsequenzen der eigenen Theorie an. Folglich kann und will diese Einführung in die Details der Praxis aber nur bei Bedarf eintauchen. Ihr Ziel ist vielmehr die systematische Entfaltung tierethischer Positionen und diese organisiert sich entlang der im Folgenden skizzierten vier Fragestellungen. Dort, wo sich theoretische Tierethiken indes deutlich zu praktischen Konsequenzen positionieren, lassen sie sich in aller Regel einer der vier praktischen Tierethiken zuordnen.
2.1.1Anthropologische Differenz
Aus tierethischer Sicht gab es einmal eine Zeit, in der die Mensch-Tier-Beziehung relativ einfach organisiert war. Dort herrschte, zumindest in westlichen Traditionen, lange die Überzeugung vor, es gäbe eine klare Grenze zwischen den Menschen (also uns) und den Tieren (den anderen). Begründet wurde diese Grenze mit dem Verweis auf bestimmte Eigenschaften bzw. Fähigkeiten, die der Mensch dem Tier voraushabe, und die eine asymmetrische moralische Hierarchie rechtfertigten, sprich: die den Menschen wertvoller machten als das Tier und damit die Nutzung von Tieren zu menschlichen Zwecken moralisch zulasse.
Die traditionellen Kandidaten für derart ausschlaggebende Eigenschaften bzw. Fähigkeiten waren für gewöhnlich Werkzeuggebrauch, Sprachvermögen, Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zu moralischem Handeln und immer wieder die Rationalität. Insbesondere die Rationalität hatte (und hat womöglich immer noch) die größte Anhängerschaft.
Man spricht in diesem Zusammenhang von der sog. anthropologischen Differenz. Dieser Begriff bringt eben jene Annahme zum Ausdruck, dass es zum Wesen des Menschen gehöre, aufgrund des Besitzes spezieller Fähigkeiten oder Eigenschaften in einer grundsätzlichen Weise wertvoller zu sein als ein Tier. Die moralische Grenze zwischen Mensch und Tier ist in dieser Annahme absolut und Tiere seien, wenn überhaupt, nur indirekt zu schützen, etwa damit ihr Nutzen für den Menschen nicht Schaden nehme. Viele große Namen westlicher Philosophie haben in der einen oder anderen Weise eine solche anthropologische Differenz angenommen, etwa RENÉ DESCARTES (1596–1650), DAVID HUME (1711–1776) oder Immanuel Kant (1724–1804).
Der Kerngedanke der anthropologischen Differenz besagt also, dass es eine moralisch relevante Eigenschaft (oder Eigenschaftsgruppe) gibt, die allen, und zwar ausschließlich Menschen zukommt. Die US-amerikanische Philosophin Lori Gruen, eine der wichtigsten tierethischen Stimmen im englischsprachigen Raum, hat daraus zwei Implikationen destilliert. (1) Zum einen impliziert diese Annahme, dass auch tatsächlich kein nichtmenschliches Tier (also kein Lebewesen, das nicht zur Spezies Homo sapiens gehört) diese Eigenschaften ebenfalls aufweist. (2) Zum anderen impliziert diese Annahme, dass keinem Mitglied der Spezies Homo sapiens selbst diese Eigenschaften fehlt (vgl. Gruen 2011).
Читать дальше