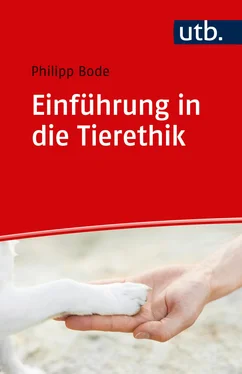Die wohl auf häufigsten genannte Eigenschaft ist dabei die Empfindungs- bzw. Leidensfähigkeit. Fühlende Wesen, so die Annahme, verdienen grundsätzlich moralische Rücksichtnahme. Dabei darf allerdings nicht der Fehler begangen werden, die Fähigkeit, etwas empfinden zu können nur auf Schmerzempfinden zu reduzieren. Lebewesen können in vielfältiger Weise empfinden und leiden, auch ohne körperlichen Schmerz (vgl. Rollin 2008, 45). In diesem umfassenden Sinn gelte es folglich, alle Lebewesen, denen es besser oder schlechter gehen kann, moralische Rücksicht zukommen zu lassen.
Viele dieser Tierethiken begründen dies mit dem Hinweis darauf, dass empfindungsfähige Lebewesen ein Interesse am eigenen Überleben haben. Dieses Interesse muss keinesfalls ein bewusstes sein, aber, so die Überlegung, wir haben Grund zu der Annahme, dass empfindungsfähige Lebewesen sich selbst, wenn auch nur rudimentär, als existent ansehen.
Der Bereich moralisch relevanter Eigenschaften kann allerdings auch enger gefasst werden, indem zur reinen Empfindungsfähigkeit weitere hinzutreten. Konkret geht es um die Fähigkeiten des Selbstbewusstseins (Bewusstsein des eigenen Wohls) und Zeitbewusstseins (Erinnerungen und Wünsche). Die Idee dahinter ist, dass nur solche Lebewesen, die diese beiden Fähigkeiten zumindest in rudimentärer Form aufweisen, ein Interesse am eigenen Wohlbefinden ausprägen können. Lebewesen, die diese beiden Fähigkeiten nicht aufweisen, sind zwar immer noch empfindungsfähig, können aber kein Interesse am eigenen wohlbefindlichen Überleben haben, weil sie sich selbst nicht als existent erfahren. Dieser Bereich von Wesen wird in aller Regel mit dem Begriff der Person markiert. Eine derartige Tierethik würde allein Personen einen moralischen Status zuerkennen, eben weil sie über bestimmte (moralisch relevante) Eigenschaften verfügen, die andere Lebewesen nicht aufweisen. Ob es sich bei Personen ausschließlich um Menschen handelt, ist dabei noch völlig offen.
Tierethiken, die Tieren aufgrund bestimmter Eigenschaften oder Fähigkeiten einen moralischen Status zuerkennen, erkennen damit zeitgleich an, dass es notwendigerweise zu Konflikten zwischen tierlichen und menschlichen Belangen oder Interessen kommen kann, und müssen somit stabile Argumente für eine Lösung dieser Konflikte entwickeln. Moralkonzeptionen, die solche Konflikte nicht zulassen, werden entweder immer zugunsten der Menschen also anthropozentristisch argumentieren (was eigentlich immer der Fall ist) oder sie argumentieren immer zugunsten der Tiere (was eigentlich nie der Fall ist). Die große Mehrheit tierethischer Moralkonzeptionen aber lässt solche Konflikte zu und ist um entsprechende, unterschiedlich verbindliche Lösungen bemüht.
2.1.4Aufnahme in die moralische Gemeinschaft
Wenn Moraltheorien Konflikte zwischen menschlichen und tierlichen Belangen zulassen, dann deshalb, weil sie die prinzipielle Aufnahme bestimmter Tiere in die moralische Gemeinschaft befürworten. Im Wesentlichen nutzen diese Moraltheorien eine von zwei Begründungs-strategien, um diese Aufnahme zu begründen.
(1) Die eine Begründungsstrategie haben wir bereits kennengelernt. Sie versucht die zu Beginn erwähnte anthropologische Differenz durch das Zugeständnis zu überwinden, dass viele Tiere mit Blick auf die zur Debatte stehenden Fähigkeiten bzw. Eigenschaften (Empfindungsfähigkeit, Rationalität, Personalität usw.) dem Menschen hinreichend ähnlich genug sind, um in die Gruppe moralisch zu berücksichtigender Wesen mit aufgenommen zu werden. Statt trennender Merkmale werden nun Gemeinsamkeiten herausgestellt, und zwar in der Absicht, die Speziesgrenze als moralische Trennlinie zwischen Mensch und Tier zu überwinden. Die moralische Gemeinschaft soll folglich, so die Forderung, erweitert werden. Man spricht daher vom Extensionsmodell (vgl. McReynolds 2004).
Es ist also nicht mehr eine Gruppenzugehörigkeit ausschlaggebend für moralische Berücksichtigung (zum Beispiel die biologische Zugehörigkeit zur Spezies Homo sapiens), sondern die jeweiligen individuellen Eigenschaften bzw. Fähigkeiten. Und das bedeutet umgekehrt: Sobald zwei Wesen ungleiche moralische Berücksichtigung erfahren, muss dies auch mit Bezug auf die individuellen Eigenschaften dieser Wesen gerechtfertigt werden (vgl. Rachels 1990, 173). Das Extensionsmodell sagt allerdings noch nichts über die Bedeutung und die Konsequenzen einer solchen Erweiterung aus. Wie wir sehen werden, kann die Erweiterung der moralischen Gemeinschaft durchaus unterschiedlich aussehen, will sagen: unterschiedlich radikal sein. Das ist allein schon deswegen der Fall, weil das Extensionsmodell in jedem Fall eine moralische Begrenzung menschlichen Handelns impliziert.
Die Begründungsstrategie, wonach Wesen nicht mehr aufgrund bestimmter Gruppenzugehörigkeit, sondern aufgrund ihrer individuellen, für eine moralische Berücksichtigung relevanten Eigenschaften zusammengefasst werden, heißt moralischer Individualismus. Wie wir noch sehen werden, ist der moralische Individualismus die mit Abstand am häufigsten anzutreffende tierethische Moraltheorie. Das ist auch nicht überraschend, gestattet sie doch „einen leicht nachzuvollziehenden und übersichtlichen Zugang zu der Frage […], wie Tiere begründet in die moralische Gemeinschaft aufgenommen werden können“ (Grimm/Wild 2016, 52–53).
Tierethiker haben mit Blick auf den moralischen Individualismus also einiges zu tun: Sie müssen nicht nur klären, welche Eigenschaften warum moralisch relevant sein sollen – das sind ethische Fragen. Sie müssen auch angeben können, auf welche Tiere das eigentlich zutrifft – und das sind in erster Linie empirische Fragen. Hier ist also nicht nur philosophisches, sondern auch biologisches, psychologisches und wohl auch kognitionswissenschaftliches Wissen gefragt.
(2) Es hat sich allerdings früh Skepsis bemerkbar gemacht hinsichtlich der Abhängigkeit einer moralischen Berücksichtigung allein von Eigenschaften bzw. Fähigkeiten. Insbesondere aus dieser Skepsis speist sich die zweite Begründungsstrategie für eine moralische Berücksichtigung von Tieren. Diese Strategie legt ihr Gewicht nun nicht auf faktische Eigenschaften (wie etwa den Umstand, ein empfindungsfähiges Lebewesen zu sein), sondern auf die tatsächlichen, in der Praxis gelebten Beziehungen zwischen Menschen und Tieren. In diesen realen Beziehungen würden ebenfalls normative Regeln zum Vorschein kommen, die sich nicht auf Eigenschaften eines Individuums reduzieren ließen.
Eine solche Position, die ihren Fokus auf die praktischen Beziehungen zwischen Mensch und Tier legt, nennt man Relationismus. Ein solcher Relationismus kann unterschiedlich stark ausfallen. Manche Relationisten konzentrieren sich allein auf die normativ geregelte Praxis, andere kombinieren ihren Relativismus mit dem moralischen Individualismus. Auch diese Positionen werden wir kennenlernen.
2.1.5Gewichtung moralisch relevanter Belange
Erinnern wir uns: Zunächst hatten wir die typischen Eigenschaften kennengelernt, mit denen die Erweiterung der moralischen Gemeinschaft (das Extensionsmodell) gängigerweise operiert. Im Anschluss haben wir gesehen, dass es neben dem moralischen Individualismus, auf dem das Extensionsmodell beruht, noch eine zweite Argumentationsstrategie für die Aufnahme von Tieren in die moralische Gemeinschaft gibt, den Relationismus.
Wenn wir es also mit einer Argumentationsstrategie zu tun haben, die Tiere in die moralische Gemeinschaft mit aufnimmt, und wenn eine diese Strategien nutzende Moraltheorie Konflikte zwischen menschlichen und tierlichen Belangen zulässt (und das tun beide), dann bleibt für den Moment noch eine letzte Frage zu klären, nämlich die jeder auf Gleichheit ausgerichteten Moraltheorie zugrunde liegende Frage, ob alle Mitglieder der moralischen Gemeinschaft auch tatsächlich als Gleiche anerkannt und respektiert werden, oder ob womöglich begründbare Hierarchien dieser Lebewesen existieren, was bedeutet, dass zwar die moralische Gemeinschaft durchaus Tiere mit einschließt, innerhalb dieser Gemeinschaft allerdings Abstufungen des moralischen Status begründbar wären. Also wieder eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten.
Читать дальше