Die Diskussion der inneren Wahrscheinlichkeit von Lesarten setzt oft ein hohes Maß an exegetischer und theologiegeschichtlicher Kenntnis voraus. Sprachgebrauch und theologische Tendenz des Autors wollen bedacht sein, und häufig muss die theologische Diskussion einer bestimmten Epoche der Kirchengeschichte bekannt sein, um Glättungen und Ergänzungen als solche erkennen zu können.
3.7 Übung
Textkritische Analyse von Mk 7,24 (nach Nestle-Aland 28)
1. Variante
Äußere Bezeugung: ’Eκεῖθεν δέ ἀναστάς lesen die Majuskeln  01, B 03, L 019, Δ 037; die Minuskeln 892, 1241, 1424, sowie eine Randlesart der syrischen Harklensis. Dagegen lesen die Majuskeln A 02, K 017, N 022, Γ 036, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13; die Minuskeln 28.33.565.700.2542, mit Abweichungen D 05 und 579, der Mehrheitstext sowie die Harklensis καὶ ἐκεῖθεν ἀναστάς. Die Majuskel W 032, die Itala sowie der Sinai-Syrer lesen lediglich καὶ ἀναστάς. Das Lektionar 2211 liest: ἀναστὰς ό κύριος ἡμῶν Ίησοῦς Χριστός.
01, B 03, L 019, Δ 037; die Minuskeln 892, 1241, 1424, sowie eine Randlesart der syrischen Harklensis. Dagegen lesen die Majuskeln A 02, K 017, N 022, Γ 036, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13; die Minuskeln 28.33.565.700.2542, mit Abweichungen D 05 und 579, der Mehrheitstext sowie die Harklensis καὶ ἐκεῖθεν ἀναστάς. Die Majuskel W 032, die Itala sowie der Sinai-Syrer lesen lediglich καὶ ἀναστάς. Das Lektionar 2211 liest: ἀναστὰς ό κύριος ἡμῶν Ίησοῦς Χριστός.
Kommt den zuletzt genannten Lesarten schon wegen ihrer geringen äußeren Bezeugung nicht als ursprünglicher Text in Frage, so sind die beiden anderen Lesarten von der äußeren Bezeugung her etwa gleichwertig. Für die textkritische Entscheidung müssen somit innere Kriterien hinzugezogen werden.
Innere Bezeugung: Das καί der zweiten Lesart anstelle des bei Mk seltenen δέ könnte man als Paralleleinfluss von Mt 15,21 erklären. Wahrscheinlicher ist aber ein Einfluss von Mk 10,1, wo der Versanfang lautet: καὶ ἐκεῖθεν ἀναστάς. Dies ist um so wahrscheinlicher, als Mk 10,1 über den Anfang des Verses hinaus Parallelen zu 7,24 bietet.
Textkritisches Urteil: Nimmt man einen Einfluss von Mk 10,1 auf Mk 7,24 im Verlauf der Textüberlieferung an, so ist die Lesart ἐκεῖθεν δὲ ἀναστάς als die ursprüngliche anzusehen. Allerdings ist in diesem Fall keine Eindeutigkeit zu erreichen, was sich schon an den unterschiedlichen Entscheidungen von Nestle-Aland 27.28und Huck-Greeven zeigt.
2. Variante
Äußere Bezeugung: Die Lesart τὰ ὅρια wird durch die Majuskeln  01, B 03, D 05, L 019, W 032, Δ 037, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13, die Minuskeln 28, 579, 700, 892, 2542, l 2211 sowie den Kirchenvater Origenes bezeugt. Hingegen lesen die Majuskel A 02, K 017, N 022, Γ 036, die Minuskeln 1241, 1424 und der Mehrheitstext τὰ μεθόρια. Schließlich liest die Minuskel 565 τὰ ὅρη.
01, B 03, D 05, L 019, W 032, Δ 037, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13, die Minuskeln 28, 579, 700, 892, 2542, l 2211 sowie den Kirchenvater Origenes bezeugt. Hingegen lesen die Majuskel A 02, K 017, N 022, Γ 036, die Minuskeln 1241, 1424 und der Mehrheitstext τὰ μεθόρια. Schließlich liest die Minuskel 565 τὰ ὅρη.
Die äußere Bezeugung spricht deutlich für die erste Lesart, obgleich die zweite Lesart im Gegensatz zur dritten auch gut bezeugt ist.
Innere Bezeugung: τὰ μεθόρια ist Hapaxlegomenon im NT und zweifellos die schwierigere Lesart. Zudem kann man für τὰ ὅρια Paralleleinfluss aus Mt 15,22 (τῶν ὁρίων) und Mk 10,1 annehmen.
Textkritisches Urteil: Für die Ursprünglichkeit von τὰ ὅρια spricht vor allem die gute äußere Bezeugung. Andererseits sprechen innere Kriterien für τὰ μεθόρια; denn es ist Hapaxlegomenon und ein Einfluss aus Mt 15,22 und Mk 10,1 ist nicht auszuschließen. Das textkritische Urteil hängt somit von der unterschiedlichen Wertung der äußeren und inneren Kriterien ab, was wiederum durch die divergierenden Meinungen von Nestle-Aland 27.28und Huck-Greeven belegt wird.
3. Variante
Äußere Bezeugung: Nach dem Wort Τύρου lesen die Majuskeln  01, A 02, B 03, K 017, N 022, Γ 036, die Minuskelfamilien 1 und 13, die Minuskeln 33, 579, 700, 892, 1241, 1424, 2542, l 2211, der Mehrheitstext, die lateinische Überlieferung, die Peschitta, die Harklensis sowie die koptischen Übersetzungen καὶ Σιδῶνος. Nur Tyrus als Ortsangabe bezeugen hingegen die Majuskeln D 05, L 019, W 032, Δ 037, Θ 038, die Minuskeln 28, 565, die Itala, der Sinai-Syrer und Origenes. Nach der äußeren Bezeugung ist der ersten Lesart eindeutig der Vorzug zu geben.
01, A 02, B 03, K 017, N 022, Γ 036, die Minuskelfamilien 1 und 13, die Minuskeln 33, 579, 700, 892, 1241, 1424, 2542, l 2211, der Mehrheitstext, die lateinische Überlieferung, die Peschitta, die Harklensis sowie die koptischen Übersetzungen καὶ Σιδῶνος. Nur Tyrus als Ortsangabe bezeugen hingegen die Majuskeln D 05, L 019, W 032, Δ 037, Θ 038, die Minuskeln 28, 565, die Itala, der Sinai-Syrer und Origenes. Nach der äußeren Bezeugung ist der ersten Lesart eindeutig der Vorzug zu geben.
Innere Bezeugung: Für die sekundäre Hinzufügung von καὶ Σιδῶνος zum ursprünglichen Τύρου spricht einmal, dass Sidon und Tyrus sowohl im Alten Testament (vgl. Jes 23,4; Jer 27,3; 47,4; Joel 13,48; Sach 9,2) als auch im Neuen Testament (Mt 11,21.22; 15,21; Mk 3,8; 7,31; Lk 6,17; 10,13.14) in der Regel zusammen genannt werden und deshalb καὶ Σιδῶνος unter dem Einfluss von Mt 15,21 wahrscheinlich nachträglich hinzugesetzt wurde. Außerdem läge eine Doppelung der Ortsangaben in Mk 7,24 und 7,31 vor, wenn Sidon und Tyrus auch in 7,24 zusammen genannt würden. Schließlich trifft hier die Regel zu, dass die kürzere Lesart die schwierigere ist.
Textkritisches Urteil: Obwohl die äußere Bezeugung eindeutig für die Lesart Τύρου καὶ Σιδῶνος spricht, ist καὶ Σιδῶνος als spätere Hinzufügung anzusehen, die unter dem Einfluss von Mt 15,21 in den Text kam.
4. Variante
Äußere Bezeugung: Anstelle des Imperfekts ἤθελεν lesen  01, Δ 037, die Minuskelfamilie 13, die Minuskel 565 sowie Origenes die Aoristform ἠθέλησεν.
01, Δ 037, die Minuskelfamilie 13, die Minuskel 565 sowie Origenes die Aoristform ἠθέλησεν.
Innere Bezeugung: eine inhaltliche Differenz zwischen der Imperfekt- und der Aoristform besteht nicht.
Textkritisches Urteil: Die äußere Bezeugung spricht für die Ursprünglichkeit des Imperfekts ἤθελεν.
5. Variante
Äußere Bezeugung: Die korrekte Aoristbildung ἠδυνήθη wird durch die Majuskeln A 02, D 05, K 017, L 019, N 022, W 032, Γ 036, Δ 037, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13, die Minuskeln 28.579.700. 892.1241.1424.2542, das Lektionar 2211 sowie den Mehrheitstext bezeugt. Hingegen findet sich im Sinaiticus und im Vaticanus die singuläre Aoristform ἠδυνάσθη. Die Imperfektbildung ἠδύνατο wird nur durch die Minuskel 565 belegt. Die beiden ersten Lesarten sind gleich gut bezeugt, so dass innere Kriterien herangezogen werden müssen.
Innere Bezeugung: Die im Neuen Testament nur hier zu findende Aoristbildung ἠδυνάσθη ist zweifellos die schwierigere Lesart. Es ist zu vermuten, dass sie in das korrekte ἠδυνήθη geändert wurde.
Textkritisches Urteil: Da ἠδυνάσθη die ‚lectio difficilior‘ darstellt und auch äußerlich gut bezeugt ist, muss es als ursprünglich angesehen werden.
3.8 Aufgabe
Textkritische Analyse von Mk 14,22–25; Lk 22,17–20, 1Kor 11,23–26 sowie Joh 1,1–18 auf der Grundlage von Nestle-Aland 28und Huck-Greeven.
11 Vgl. zur problematischen Methode der Konjektur B. M. Metzger, Der Text des Neuen Testaments, 184–187. – Wer die Begründung einer Konjektur kennenlernen möchte, lese A. v. Harnack, Zwei alte dogmatische Korrekturen im Hebräerbrief, in: Studien zur Geschichte des Neuen Testaments und der alten Kirche I, AKG 19, 1931, 234–252.
12 Der Ausdruck ‚textus receptus‘ geht auf das Vorwort der 1633 erschienenen 2. Auflage der NT-Ausgabe der Familie Elzevier aus Leiden zurück, wo es heißt: »Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum aut corruptum damus« (»Du hast nunmehr einen Text, der von allen angenommen ist, in dem wir nichts verändert oder verdorben wiedergeben«).
13 Vgl. zur aufregenden Fundgeschichte Chr. Böttrich, Der Jahrhundertfund, 2011; D. Parker, Der Codex Sinaiticus, 2012.
14 Zu den Einzelheiten der Theorie von Westcott-Hort vgl. B. M. Metzger, a.a.O., 129–138.
Читать дальше
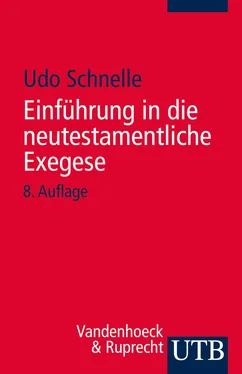
 01, B 03, L 019, Δ 037; die Minuskeln 892, 1241, 1424, sowie eine Randlesart der syrischen Harklensis. Dagegen lesen die Majuskeln A 02, K 017, N 022, Γ 036, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13; die Minuskeln 28.33.565.700.2542, mit Abweichungen D 05 und 579, der Mehrheitstext sowie die Harklensis καὶ ἐκεῖθεν ἀναστάς. Die Majuskel W 032, die Itala sowie der Sinai-Syrer lesen lediglich καὶ ἀναστάς. Das Lektionar 2211 liest: ἀναστὰς ό κύριος ἡμῶν Ίησοῦς Χριστός.
01, B 03, L 019, Δ 037; die Minuskeln 892, 1241, 1424, sowie eine Randlesart der syrischen Harklensis. Dagegen lesen die Majuskeln A 02, K 017, N 022, Γ 036, Θ 038, die Minuskelfamilien 1 und 13; die Minuskeln 28.33.565.700.2542, mit Abweichungen D 05 und 579, der Mehrheitstext sowie die Harklensis καὶ ἐκεῖθεν ἀναστάς. Die Majuskel W 032, die Itala sowie der Sinai-Syrer lesen lediglich καὶ ἀναστάς. Das Lektionar 2211 liest: ἀναστὰς ό κύριος ἡμῶν Ίησοῦς Χριστός.










