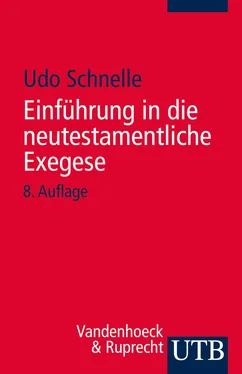http://egora.uni-muenster.de/intf/
Neben dem New Testament Virtual Manuscript Room ist das als Prototyp bereit gestellte Hilfsmittel New Testament Transcripts, in das Transkriptionen von bedeutenden ntl. Manuskripten (vor allem die Papyri und die großen Bibelhandschriften) eingelesen wurden, zu nennen. Zur jeweiligen NT-Stelle werden die Lesarten der eingearbeiteten Manuskripte angezeigt und kenntlich gemacht:
http://nttranscripts.uni-muenster.de/
Auch einzelne Handschriften sind inzwischen digital erfasst und können somit über das Internet auf dem jeweiligen Computer gelesen werden. Ein herausragendes Beispiel, was durch eine internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet gegenwärtig geleistet wird, ist die sukzessive digitale Erfassung des Codex Sinaticus unter Beteiligung der Universitätsbibliothek Leipzig. Neben der Handschrift wird ihr Text durch Transkription und Übersetzung zugänglich gemacht:
http://www.codexsinaiticus.com/de/
Unersetzlich für die Arbeit an den antiken Parallelen ist The Perseus Digital Library. Hier findet sich eine Anzahl von antiken Texten und (vornehmlich englischsprachigen Übersetzungen) von klassischen Autoren bis hin zu Papyri. Das Angebot umfasst auch Sekundärliteratur und Lexika:
The Perseus Digital Library
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
Für die Literatursuche ist die bibelwissenschaftliche Datenbank der Universität von Innsbruck äußerst hilfreich:
Bibelwissenschaftliche Literaturdokumentation Innsbruck (BILDI)
http://www.uibk.ac.at/bildi/
Einige für die Exegese interessante wissenschaftliche Zeitschriften stellen ihre Artikel im Internet ein 9; vgl. als Beispiele:
Biblica
http://www.bsw.org/project/biblica/
Review of Biblical Literature
http://www.bookreviews.org/
Zudem informiert der Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie der Universität Tübingen, deren Hefte im Internet eingesehen werden können, über theologische Beiträge in Fachzeitschriften, Festschriften und Kongressschriften (einsehbar für die letzten drei Monate):
http://www.ixtheo.de/zid-curr/index.html
Eine zentrale Funktion des Zeitschrifteninhaltsdienstes stellt die recherchierbare Aufsatzdatenbank dar:
http://www.ixtheo.de/
Das Internet als Informationsquelle ist nach wie vor im Wachsen begriffen. Ständig kommen neue Angebote hinzu. Um sich das Material zu erschließen, sind Suchmaschinen notwendig 10. Einige Seiten werden jedoch nicht weiter aktualisiert, aus dem Netz genommen oder wechseln kurzfristig ihre Adresse. Auch bei solcher Suche steht der Erfolg nicht immer in Relation zum Aufwand. Daher ergeben sich einige Fragen und Grundregeln, die für ein erfolgreiches Arbeiten mit dem Internet zu empfehlen sind:
Klärung vor der Recherche:
1. Warum wird das Internet benötigt?
2. Präzise Festlegung, welche Information/Hilfe die Internetrecherche erbringen soll.
3. Daraus sollten sich klare Suchbegriffe ergeben.
4. Festlegung eines Zeitlimits.
Prüfung einer zu verwendenden Internetseite:
1. Wer ist für die Seite verantwortlich und was qualifiziert diese Seite. Welchem Interesse dient die Darstellung?
2. Wann wurde die Seite zuletzt aktualisiert?
3. Entstehen bei ihrer Nutzung Kosten und in welcher Höhe?
Rezeption:
Genauer Verweis auf die Seite, Aufnahme in das Literaturverzeichnis, nachprüfbare Zitation des Inhalts und Angabe des Zugriffdatums.
Bei der Beachtung dieser einfachen Grundüberlegungen ist die Beschäftigung mit dem Internet kein Freizeitvergnügen, sondern wird zu einem vollwertigen Hilfsmittel der exegetischen Arbeit.
8 Vgl. zur Einführung in die Septuaginta-Forschung R. Hanhart, Septuaginta, in: W. H. Schmidt u.a., Altes Testament, GT 1, 1989, 176–196.
9 Zum aktuellen Publikations- und Leistungsstand vgl. folgende Linkliste: http://www.ntgateway.com/tools-and-resources/journals/.
10 Für die Suche können die bekannten Internetsuchdienste verwendet werden. Hilfreiche Ratschläge für die Literaturrecherche generell aber auch zu wissenchaftlichen Suchmaschinen hält der »LOTSE Theologie« ( http://lotse.unimuenster.de/theologie/index-de.php) bereit.
3. Textkritik
Literatur
ALAND, K. u. B., Der Text des Neuen Testaments, 21989. – ALAND, K. u.a., Bibelhandschriften II, TRE 6 (1980), 114–131; Bibelübersetzungen, TRE 6, 161–215. – ELLIOTT, J. K. – MOIR, I., Manuscripts and the Text of the New Testament, 1995. – GREEVEN, H., Text und Textkritik der Bibel II. Neues Testament, RGG 3VI (1962), 716–725. – HUNGER, H. u.a. (Hg.), Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, 21988. – KÜMMEL, W. G., Einleitung, 452–491. – MAAS, P., Textkritik, 31956. – METZGER, B. M., Der Text des Neuen Testaments, 1966. – DERS., A Textual Commentary on the Greek New Testament, 21994. – PARKER, D. C., An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts, Cambridge 2008. – POKORNÝ, P. – HECKEL, U., Einleitung, 88–114. – TROBISCH, D., Die 28. Auflage des Nestle-Aland. Eine Einführung, 2013 – WIKENHAUSER, A. – SCHMID, J., Einleitung, 65–202.
3.1 Definition
Textkritik ist die Feststellung von Wortlaut und Schreibweise eines Textes, wie diese für den ursprünglichen Autor anzunehmen sind. Die Textkritik hat somit die Aufgabe, auf der Grundlage der Textzeugen den ältesten erreichbaren Text des Neuen Testaments zu rekonstruieren.
Unerlässlich ist die Textkritik aus historischen und theologischen Gründen:
a) Da die Originale (αὐτόγραφα) der neutestamentlichen Schriften nicht mehr vorhanden sind, muss der Originaltext aus der späteren Überlieferung der Texte in Handschriften, Lektionarien, Zitaten bei frühen christlichen Autoren und Übersetzungen erschlossen werden. Allein über 5.500 Abschriften auf Papyrus, Pergament und Papier liegen in griechischer Sprache vor. Dabei kann die ursprüngliche Textgestalt mit einer der überlieferten Textfassungen identisch sein. Zwar gibt es zwischen den einzelnen Textzeugen eine durchschnittliche Übereinstimmungsquote von ca. 85 Prozent, aber sie kann bei den einzelnen ntl. Schriften variieren (z. B. Apostelgeschichte, Johannesapokalypse) und es bleibt immer die Aufgabe der Textkritik, die als ursprünglich anzusehende Lesart zu finden. Selten enthält keine der überlieferten Textfassungen den ursprünglichen Text, so dass dieser hypothetisch erschlossen werden muss (Konjektur) 11. Somit ist der rekonstruierte ‚Urtext‘ neutestamentlicher Schriften eine hypothetische Größe, da er immer auf Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen beruht.
b) Geht es in der neutestamentlichen Exegese um die Auslegung und das Verstehen der neutestamentlichen Texte, so muss erarbeitet werden, was die neutestamentlichen Schriftsteller selbst uns überliefert haben, nicht aber, was in der Textüberlieferung sekundär hinzukam.
Dahinter steht auch ein hermeneutisches Interesse: Man muss zum ursprünglichen Text zurückgehen, weil nur er Auskunft über die Theologie der neutestamentlichen Schriftsteller geben kann.
3.1.1 Gegenstand der Textkritik ist also die Überlieferung von Texten, die im Original nicht mehr vorhanden sind.
3.1.2 Ziel der Textkritik ist die hypothetische Feststellung derjenigen Fassung des Textes, die der Autor einst angefertigt hat.
3.1.3 Arbeitsgrundlage sind Textausgaben mit Angaben über die divergierende Textüberlieferung und deren Bezeugung, insbesondere Nestle-Aland 27.28.
3.2 Lernziele
Die Studierenden sollen über Grundkenntnisse der Geschichte des neutestamentlichen Textes und des Wertes seiner Hauptzeugen verfügen.
Sie sollen die Fähigkeit zur technischen Benutzung des kritischen Apparates des NT Graece von Nestle-Aland 27.28besitzen und in der Lage sein, die Grundregeln textkritischer Entscheidungen anzuwenden.
Читать дальше