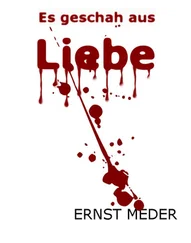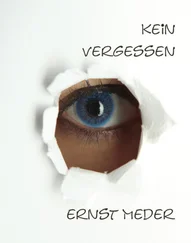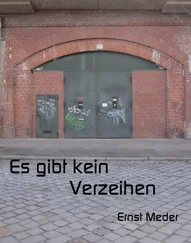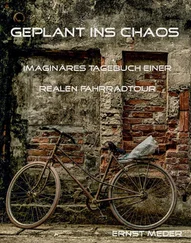Literatur
Allgemeines: FIRA (Bd. II: Autoren, 2. Auflage 1968; Bd. III: Rechtsgeschäfte, 2. Auflage 1969); HHL 4 (1997), §§ 410 ff. (Liebs); HHL 5 (1989), §§ 502 ff. (Liebs). Einen Einblick in die kaum übersehbare Literatur zum Prinzipat gewähren die beiden Sammelbände ‚Augustus‘ (hg.v.W. Schmitthenner, 1969) und ‚Prinzipat und Freiheit‘ (hg. v. R. Klein, 1969) sowie ANRW II 13 – 15; s. ferner: A. v. Premerstein, Vom Wesen und Werden des Prinzipats (1937); J. M. Kelly, Princeps iudex (1957); H. Volkmann, Zur Rechtsprechung im Prinzipat des Augustus, 2. Auflage (1969); H. Bengtson, Kaiser Augustus (1981); D. Kienast, Augustus – Princeps und Monarch (1982, 3. Auflage 1999); A. Mette-Dittmann, Die Ehegesetze des Augustus (1991); J. Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreichs (Bd. 1, 4. Auflage 1995; Bd. 2, 3. Auflage 1994); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, 5. Auflage (2008); A. Heuss, Römische Geschichte, 10. Auflage 2007 (hg.v.J. Bleicken / W. Dahlheim / H.-J. Gehrke), 272; W. Dahlheim, Augustus (2010).
Die klassische römische Rechtswissenschaft: W. Kunkel, Das Wesen des ius respondendi, SZ (RA) 66 (1948), 443; F. Wieacker, Der römische Jurist, in: Vom römischen Recht, 2. Auflage (1961), 128 und dort ders., Über das Klassische in der römischen Jurisprudenz, 161; F. Schulz, Geschichte der römischen Rechtswissenschaft (1961); M. Kaser, Zur Methode der römischen Rechtsfindung (1962); W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, 2. Auflage 1967 (ND 2001); W. Waldstein, Zu Ulpians Definition der Gerechtigkeit, in: FS W. Flume (1978), Bd. I, 213; R. Knütel, Von schwimmenden Inseln, wandernden Bäumen, flüchtenden Tieren und verborgenen [<<97] Schätzen: Zu den Grundlagen einzelner Tatbestände originären Eigentumserwerbs, in: RuP, 549; N. Benke, In sola prudentium interpretatione. Zur Methodik und Methodologie römischer Juristen, in: B. Feldner / N. Forgó (Hg.), Norm und Entscheidung. Prolegomena zu einer Theorie des Falls (2000), 1; O. Behrends, Das Geheimnis des klassischen römischen Rechts, in: B. J. Choe (Hg.), Law, Peace and Justice (2007), 3; ders., Die geistige Mitte des römischen Rechts, in: SZ (RA) 125 (2008), 25; C. Baldus, „Historische Auslegung“ in Rom? Der Umgang römischer Juristen mit dem Normtext als Methodenfrage, in: Seminarios Complutenses de Derecho Romano (2007 / 2008), 85; N. Jansen, Staatliche Gesellschaftspolitik und juristische Argumentation im römischen Privatrecht, in: FS R. Knütel (2009), 493 (s. a. die Nachweise zum 1. Kapitel); M. Avenarius, Law schools, in: R. S. Bagnall u. a. (Hg.), The encyclopedia of Ancient History (2013), 3967.
Princeps legibus solutus: D. Wyduckel, Princeps legibus solutus – Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und Staatslehre (1979); D. Liebs, Das Gesetz im spätrömischen Recht, in: Das Gesetz in Spätantike und frühem Mittelalter (hg.v.W. Sellert), 1992, 11, 23; W. Naucke, Die strafjuristische Privilegierung staatsverstärkter Kriminalität (1996), 12, 17, 47; D. Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 7. Auflage (2007), 179 (Nr. 94); J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, 7. Auflage (2013), 235; O. Behrends, Princeps legibus solutus, in: FS C. Starck (2007), 3.
Senatus Consultum Velleianum: K. L. C. Röslin, Abhandlung von besondern weiblichen Rechten, Bd. I (1775), Bd. II (1779), 53; J. J. Bachofen, Das vellejanische Senatskonsult, seine ursprüngliche Fassung und spätere Erweiterung, in: Ausgewählte Lehren des römischen Civilrechts (1848), 1; W. Girtanner, Die Bürgschaft nach gemeinem Civilrecht Bd. I (1850), 258, Bd. II (1851), 335; H. Kreller, Das Verbot der Fraueninterzession von Augustus bis Justinian, in: Anzeigen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse (1956), 10; D. Medicus, Zur Geschichte des Senatus Consultum Velleianum (1957); Kaser, RP II, 277, 667; A. D. Bautista, L’intercession des femmes dans la législation de Justinien, RIDA 1983, 81; S. Dixon, Infirmitas Sexus: Womanly Weakness in Roman Law, TRG 1984, 343; O. Lehner, Senatus Consultum Velleianum – Die Wiederkehr einer antiken Rechtsfigur im frühneuzeitlichen österreichischen Recht, in: SZ (GA) 105 (1988), 270; R. Zimmermann, The Law of Obligations (1990), 145; B. Kupisch, Die Frau im römischen Geschäftsleben, in: U. Hübner / W. Ebke (Hg.), FS B. Großfeld (1999), 659; W. Ernst, Interzession: Vom Verbot der Fraueninterzession über die Sittenwidrigkeit von Angehörigenbürgschaften zum Schutz des Verbrauchers als Interzedenten, in: RuP, 395; U. Mönnich, Frauenschutz vor riskanten Geschäften. Interzessionsverbote nach dem Velleianischen Senatsbeschluss (1999); St. Meder, Interzession und Privatautonomie, in: GS M. Wolf (2011), 253. [<<98]
12WuG, 662, 664. Zur besonderen Art des Gehorsams, den das Charisma fordert, vgl. bereits R. Sohm (Kirchenrecht, Bd. I, 1892, 26).
13An die Stelle eines durch lebenslange Gewaltunterworfenheit bestimmten Status (S. 39) ist eine weitgehende Gleichstellung der Geschlechter getreten. Denn das klassische Recht hat den Begriff persona (S. 68, 109) auch auf Frauen erstreckt. Frauen waren zwar weiterhin von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Diese Ungleichbehandlung haben die klassischen Juristen aber nicht geschlechtsspezifisch, etwa mit dem Hinweis auf geringere Befähigung oder mangelndes Urteilsvermögen, sondern gewohnheitsrechtlich begründet. Das Gewohnheitsrecht erkannten sie als wichtige Rechtsquelle zwar an, haben ihm jedoch nicht das gleiche Maß an innerer Rationalität wie dem universalen ius gentium beigemessen (vgl. O. Behrends, Die geistige Mitte des römischen Rechts, 25, 34).
4. Kapitel
Die römische Spätzeit bis zur Justinianischen Kodifikation
Unter den Nachfolgern des Augustus werden die innerhalb der Monarchie verbliebenen republikanischen Strukturen allmählich abgebaut. Die Folge ist ein steter Machtzuwachs des Prinzeps. Seit Domitian (81 – 96 n. Chr.) lassen sich die Kaiser immer wieder mit Domine anreden, was etwa Augustus noch ausdrücklich abgelehnt hat. Die Bündelung von Entscheidungskompetenzen führt zunächst zu einer besseren Verwaltung der Provinzen, deren Bewohner 212 n. Chr. alle das römische Bürgerrecht erhalten (constitutio Antoniniana). Im zweiten Abschnitt der Kaiserzeit tritt an die Stelle des gemäßigten das absolute Kaisertum. Diokletian (284 – 305 n. Chr.) führt das orientalische Hofzeremoniell ein, welches ihm die Majestät eines höheren Wesens mit beinahe metaphysischem Symbolgehalt verleiht. Als absoluter Herr und Gott (dominus et deus) ist der Kaiser nunmehr unbestrittener Mittelpunkt des Reiches. Die Thronbesteigung Diokletians (284) markiert den Beginn der römischen Spätantike. Die durch den allmächtigen Kaiser bestimmte Herrschaftsform der Spätantike pflegt man als ‚Dominat‘ zu bezeichnen (Mommsen). 14
Die nachklassische Periode der römischen Jurisprudenz reicht vom 3. Jahrhundert n. Chr. bis zum Ausgang der Antike. Sie zeigt Zeichen des Niedergangs, wenngleich einige Kaiser – allen voran Diokletian – bemüht sind, an die klassische Jurisprudenz anzuknüpfen. Das absolute Kaisertum erhebt sich zum alleinigen Gesetzgeber und lässt einer freien, [<<99] nur dem eigenen Gewissen des Juristen verantwortlichen Rechtspflege und Rechtswissenschaft kaum noch Raum. Die Entwicklung mündet in den spätantiken Zwangsstaat mit einem umfassenden bürokratischen Apparat. Die republikanischen Institutionen sind bald völlig verschwunden. Die äußeren Bedingungen werden durch eine sich zunehmend verschärfende Notlage der Massen – hohe Steuern, Rückgang des Handels und Verkümmerung des Geldwesens – geprägt. Der wirtschaftliche Verfall geht Hand in Hand mit einem kulturellen Niedergang, welcher auch in der Pflege der Jurisprudenz deutliche Spuren hinterlässt. Infolge der Abwendung von der klassischen Tradition kommt es allmählich zu einer Vulgarisierung des Rechts.
Читать дальше