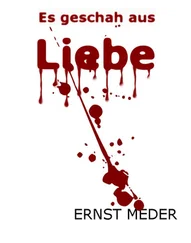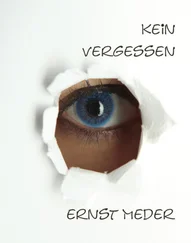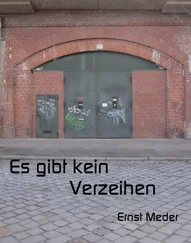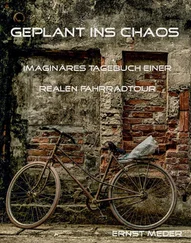1. Rechtsquellen und Rechtsliteratur in der Zeit der Nachklassik
Die klassischen Gesetzesarten ( 3. Kapitel 4, S. 88.) bleiben zwar weitgehend erhalten, werden aber zunehmend kaiserlicher Kontrolle unterworfen. Im Dominat darf nur noch der Kaiser das Recht fortbilden. Seine Rechtsetzungsakte treten jetzt als Gesetze (leges, constitutiones) dem überkommenen Juristenrecht (ius) gegenüber. Allgemeine Gesetze (leges generales) begegnen z. B. in Gestalt kaiserlicher Schreiben an hohe Beamte oder in Form von Edikten, worin sich der Kaiser an die Bevölkerung des ganzen Reiches oder eines Teilgebietes wendet. Als Gesetz (lex) werden immer häufiger auch sonstige kaiserliche Regelungen ohne Allgemeinverbindlichkeit bezeichnet. So rücken die kaiserlichen Reskripte (S. 89) ebenfalls zunehmend in die Nähe von Gesetzen und Ulpian kann schreiben, dass, was der Kaiser beschlossen habe, Gesetzeskraft besitze (D. 1.4.1). Darüber hinaus gewinnen persönliche Vergünstigungen oder Vergünstigungen für Körperschaften (adnotationes) an Bedeutung, die auch pragmaticum, pragmatica lex oder sanctiones pragmaticae genannt werden. Die Privilegien sollen nur für die Begünstigten und nur im Rahmen der Gesetze gelten, wogegen in der Praxis aber oft verstoßen wurde.
Die Kaiser haben ihre Gesetze nicht selbst verfasst, sondern in den großen Zentralkanzleien vorbereiten und ausformulieren lassen. Mit dieser [<<100] Aufgabe ist vor allem der quaestor sacri palatii (Chef des Justizwesens) betraut. Schon während des Prinzipats hat der kaiserliche quaestor Gesetzesanträge im Senat entworfen. So formulierte etwa Julian (S. 87) als quaestor Hadrians den berühmten Senatsbeschluss zur abschließenden Festlegung des prätorischen Edikts (S. 85). Als quaestor sacri palatii pflegt man den Justizchef erst seit Konstantin (306 – 337) zu bezeichnen. Das Amt gewinnt in der Spätantike erhebliche Bedeutung. Den quaestor sacri palatii unterstützen mehrere Kanzleibeamte, wobei etwa der magister libellorum die kaiserlichen Antwortschreiben (rescripta) auf Eingaben aus der Bevölkerung vorbereitet, der magister epistularum die Antworten auf Anfragen von Reichsbeamten und Eingaben hochgestellter Persönlichkeiten bearbeitet und der magister memoriae die kaiserlichen Vergünstigungen (adnotationes) entwirft und sie nach Unterzeichnung durch den Kaiser ausliefert.
Verlautbarungen im Namen des Kaisers sind uns in großer Zahl erhalten. Unter Diokletian werden die Kaiserkonstitutionen in zwei Sammlungen zusammengefasst – dem Codex Gregorianus und dem Codex Hermogenianus. Die Sammlungen tragen den Namen ihrer Herausgeber, Gregorius und Hermogenian, die jeweils als Kanzleivorsteher tätig waren. Von beiden Codices sind nur Bruchstücke erhalten. Der Codex Gregorianus ist in den Codex Justinians ( 4. Kapitel 4, S. 109.) eingegangen und lässt sich daher gut rekonstruieren. Außerdem enthält die Lex Romana Visigothorum (5. Kapitel 2.1, S. 129) einen schmalen Auszug aus dieser bis zum Jahr 291 geführten Sammlung. In dem ähnlich konzipierten Codex Hermogenianus sind die – überwiegend von Hermogenian während seiner Kanzleitätigkeit selbst entworfenen – Reskripte Diokletians aus den Jahren 293 und 294 gesammelt. In der Folgezeit entstehen Neuausgaben, die um jüngeres Material erweitert werden. Nach dem Vorbild der Codices Gregorianus und Hermogenianus ist eine amtliche Sammlung der Kaiserkonstitutionen durch Theodosius II. (408 – 450) zunächst im Osten verkündet, von Valentinian III. (425 – 455) für den Westen übernommen und für das Gesamtreich 439 in Kraft gesetzt worden (S. 107). Dieser fast vollständig erhaltene, ebenfalls in der kaiserlichen Kanzlei entstandene Codex Theodosianus umfasst sechzehn, in einzelne Titel gegliederte Bücher mit über 3000 chronologisch geordneten Konstitutionen. Die [<<101] maßgebliche moderne Ausgabe des Codex Theodosianus stammt von Th. Mommsen (s. Literaturhinweise).
Die Eingriffe der Kaiser in die Rechtspflege beschränken sich nicht auf den Erlass von Konstitutionen. Auch den Umgang mit der klassischen Rechtsliteratur suchen sie zu kontrollieren. Denn die alten Juristen genießen nach wie vor hohes Ansehen. Hinzu kommt, dass es in der Spätantike Sache der Parteien oder ihrer Anwälte ist, dem Richter die entscheidungserheblichen Normen vorzutragen. Da die Meinungen der alten Juristen noch immer als Rechtsquelle gelten, stützen die Anwälte ihre Einlassungen vor Gericht nicht nur auf kaiserliche Verlautbarungen, sondern auch auf Juristenrecht, das die Richter dann zu berücksichtigen haben. Die Richter aber sind schlecht ausgebildet, sie geraten in Schwierigkeiten, wenn sich streitende Parteivertreter auf jeweils abweichende Juristenmeinungen berufen. Die Prozesse laufen so Gefahr, mehr und mehr zu einer Art Lotteriespiel zu verkommen.
Zur Beseitigung der Missstände versucht Theodosius II. neben Gesetzen (constitutiones, leges) auch das vielschichtige Juristenrecht (ius) in seinen Codex eingliedern zu lassen. Das Vorhaben kann jedoch nicht verwirklicht werden – vermutlich, weil sein quaestor sacri palatii der schwierigen Materie nicht gewachsen ist. In den Codex Theodosianus gelangt aber ein Normtext aus dem Jahre 426, der Kriterien zur Beschränkung und Kontrolle der Anwendung von Juristenschriften aufstellt. Den als ‚Zitiergesetz‘ bezeichneten Text pflegt man als Beispiel für den Niedergang der Rechtskultur im Dominat anzusehen, weil er die klassischen Juristen zu bloßen Rechnungsposten einer juristischen Kalkulation herabwürdige und autoritatives Denken an die Stelle selbständiger Forschung treten lasse (Bretone). Vielleicht aber ist das Zitiergesetz auch nur ein Notbehelf, um den Einfluss von Juristenschriften auf den Prozess berechenbar zu halten:
Wir bestätigen die Geltung sämtlicher Schriften von Papinian, Paulus, Gaius, Ulpian und Modestin, so daß also Gaius dasselbe Ansehen genießt wie Paulus, Ulpian und die übrigen und daß Belegstellen aus seinem ganzen Werk angeführt werden können. Auch die Erkenntnisse der Autoren, deren Erörterungen und Ansichten alle die Genannten in ihre Werke aufgenommen [<<102] haben, erklären wir für gültig, z. B. die des Quintus Mucius Scävola, Sabinus, Julian und Marcellus sowie all derer, die von den Genannten ständig angeführt werden, vorausgesetzt, daß der Text ihrer Werke – in Anbetracht der altersbedingt unsicheren Überlieferung – durch den Vergleich mehrerer Handschriften gesichert ist. Wo aber unterschiedliche Ansichten vorgebracht werden, dort soll die größere Zahl der Autoren maßgeblich sein, oder wenn das Zahlenverhältnis gleich ist, dann soll das Ansehen der Seite den Vorrang haben, auf der sich die herausragende Einsicht Papinians hervortut, des Mannes, der zwar zwei anderen unterliegt, gegenüber einzelnen jedoch die Oberhand behält. Auch setzen wir fest, daß die kritischen Anmerkungen, die Paulus und Ulpian dem Werk Papinians beigegeben haben, ungültig sind, wie schon früher angeordnet. Wo aber gleich viele Stimmen aus der Zahl der Autoren angeführt werden, die gleiches Ansehen genießen sollen, dort mag das Ermessen des Urteilenden abwägen, welcher Seite er folgen soll. Ferner bestimmen wir, daß die Sentenzen des Paulus stets einbegriffen sind. Gegeben am 7. November [426] zu Ravenna, unter dem zwölften Konsulat des Kaisers Theodosius II. und dem zweiten des Kaisers Valentinian III. (Römische Rechtstexte, 14, 17).
Die Mehrzahl der Kaisergesetze ist im Zusammenspiel von Rhetoren und Juristen konzipiert worden. Die oft pompös ausstaffierten und rhetorisch aufgepeppten Texte dienen nicht nur der Regelung rechtlicher Probleme, sondern auch den Erfordernissen staatlicher Repräsentation und der Herrscherpropaganda. Für die Sachregelungen gilt dies jedoch nur mit Einschränkungen. Sie beruhen inhaltlich auf der Vorarbeit in den Kanzleien. Die Leistungen der Kanzleijuristen sind nicht zu unterschätzen. Ihre Arbeitsweise trägt durchaus selbständigen Charakter, sie lässt sich weder auf klassische noch auf vulgare Stilformen festlegen (Voß). Viele Sachregelungen sind von dem ernsthaften Bemühen der Kanzleijuristen um eine Anpassung des traditionellen Rechts an gewandelte rechtliche und gesellschaftliche Bedingungen getragen. So überrascht es nicht, dass auch im Wege der Kaisergesetzgebung Rechtsinstitute von bleibender Bedeutung geschaffen wurden. [<<103]
Читать дальше