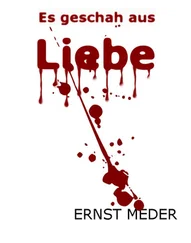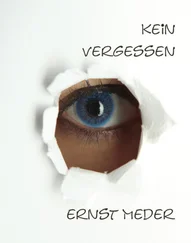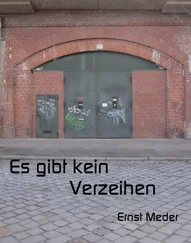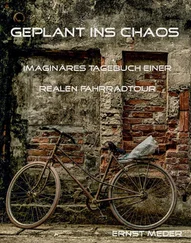2. Rechtsfortbildung durch Kaiserrecht
Berühmtes Beispiel für eine Rechtsfortbildung durch Reskripte ist das durch Diokletian geschaffene Rechtsinstitut der laesio enormis (Verletzung über die Hälfte). Den Entscheidungen liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Anwesens, offenbar um den allgemein bedrückenden ländlichen Verhältnissen zu entkommen, weit unter seinem Wert verkauft hat (C. 4.44.2). Das Verbot der laesio enormis bedeutet eine Einschränkung der Privatautonomie zum Schutz des Verkäufers vor nachteiligen Grundstücksgeschäften. Diokletian will mit Hilfe der laesio enormis vornehmlich die Landflucht eindämmen, sie passt aber auch in die allgemeine Linie seiner Bemühungen um die Festlegung eines iustum pretium (gerechter Preis). Mit dem Problem des gerechten Preises hatten sich bereits die Klassiker befasst. Repräsentativ ist die Auffassung des Paulus, der es für legitim hält, dass die Parteien einander zu übervorteilen trachten (D. 19.2.22.3). Das Aufgreifen der Frage in der Nachklassik und die Abkehr vom klassischen Standpunkt entsprechen allgemeinen Humanisierungstendenzen der Zeit, die zunächst von der stoischen Philosophie, dann aber vor allem vom Christentum gefördert wurden. Überhaupt lässt sich seit Diokletian eine zunehmende Orientierung des Rechts an ethischen Maßstäben registrieren. Danach erscheint es unzulässig, die Höhe des Kaufpreises dem freien Wettbewerb zu überlassen.
Das Verbot der laesio enormis berechtigt den Verkäufer zur Aufhebung des Vertrags, wenn der vereinbarte Preis weniger als die Hälfte des wahren Wertes ausmacht. Beruft er sich auf sein Aufhebungsrecht, so kommt es zur Rückabwicklung des Kaufvertrags. Doch kann der Käufer die Rückabwicklung verhindern, wenn er die Differenz zum vollen, ‚gerechten‘ Preis (iustum pretium) nachzahlt. Spätestens unter Justinian entwickelte sich aus den Einzelentscheidungen Diokletians eine generelle Regel. Die Umkehrung dieser Regel zugunsten des Käufers, der mehr als das Doppelte des Wertes als Kaufpreis zugesagt hat, geht wohl erst auf das Mittelalter zurück, war aber in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen der Neuzeit ebenfalls anerkannt.
Die laesio enormis hat Eingang in die großen Kodifikationen des Naturrechts, etwa in das geltende Österreichische Allgemeine Bürgerliche [<<104] Gesetzbuch (§ 934 ABGB) oder in das französische Recht gefunden (Art. 1674 Code civil). In Deutschland ist die laesio enormis durch § 282 des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs (ADHGB) von 1861 abgeschafft worden. Das BGB hat sie nicht aufgenommen; es schützt nur, und zwar beide Parteien, durch den Wucherparagraphen 138 Abs. 2 BGB. Die Anwendung des § 138 Abs. 2 BGB setzt auf Seiten des Wucherers ein Ausbeutungsbewusstsein und auf Seiten des Bewucherten einen Zustand der Schwäche oder Unterlegenheit voraus. Beides kann in der Praxis häufig nicht nachgewiesen werden. Daher hat sich das Problem heute von der Beispielsnorm des § 138 Abs. 2 BGB auf die Grundnorm des § 138 Abs. 1 BGB verlagert. So sind gemäß § 138 Abs. 1 BGB Grundstückskaufverträge nichtig, wenn zwischen dem Grundstückswert und dem Kaufpreis ein besonders auffälliges, krasses Missverhältnis besteht. Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH soll dies schon dann der Fall sein, wenn der Wert der Leistung knapp doppelt so hoch ist wie derjenige der Gegenleistung (vgl. die Nachweise bei Soergel-Hefermehl, 13. Auflage 1999, Rn. 86 a). Auch außerhalb von Grundstückskaufverträgen berücksichtigt die Judikatur Missverhältnisse zwischen dem Wert der Leistungen. Diese Rechtsprechung bildet nicht das einzige Beispiel dafür, dass römische Rechtsfiguren auch dann einen Weg zurück ins geltende Recht finden können, wenn der Gesetzgeber sich gegen ihre Aufnahme entschieden hat.
3. Die Teilung des Reiches
Der Schwerpunkt des römischen Reiches entfernt sich nunmehr zunehmend von Italien und von Rom. Es wird immer schwieriger, das Reich als Einheit zu regieren. Trotz wiederholter Raubzüge von germanischen Stämmen, zunächst vor allem in den westlichen Regionen, bemüht man sich, die Grenzen des Reiches entlang der Rhein-Donau-Linie zu halten. Die Germanen stehen ihrerseits unter dem Druck einer weiträumigen Wanderungsbewegung anderer Völker, insbesondere der gefürchteten Hunnen. Man vermutet, dass schon frühzeitig zwischen Ost- und Westgermanen unterschieden wurde. Zu den Ostgermanen zählen die [<<105] Wandalen, Burgunder und Goten. Da diese Völker alle aus dem Norden gekommen waren, kann man auch die skandinavischen Volkskreise darunter erfassen. Westgermanen sind die eigentlich deutschen Stämme: Franken, Sachsen, Schwaben, Bayern, aber auch die später in Italien sesshaft gewordenen Langobarden und die Angelsachsen. Im 4. Jahrhundert dringen die Goten auch in die östlichen Teile des Reiches ein und nähern sich Konstantinopel, der neuen Hauptstadt für den Osten. Theodosius I. (379 – 395 n. Chr.) war der letzte große Feldherr unter den Kaisern. Ihm gelingt es, die Lage noch einmal in den Griff zu bekommen – allerdings nur um den Preis eines größeren Einflusses von Barbaren.
Nach dem Tod von Theodosius I. (395) erfolgt die Teilung des römischen Reiches in ein west- und ein oströmisches Reich. In Westrom regieren seitdem Honorius (395 – 423) und Valentinian III. (425 – 455). Letzter weströmischer Kaiser ist Romulus Augustulus, der 476 von dem germanischen Söldnerführer Odoaker gestürzt wird, was zugleich die Auflösung des weströmischen Reiches bedeutet. In Italien, dem Kernland des römischen Westreichs, tritt der Ostgotenkönig Theoderich der Große (493 – 526) die Rechtsnachfolge der weströmischen Kaiser an. Theoderich handelt im Auftrag des oströmischen Kaisers Zeno, als er den Usurpator Odoaker gewaltsam absetzt. Zur Legitimation seiner Herrschaft beruft er sich ausdrücklich auf das römisch-kaiserliche Erbe, sein regnum soll „Imitation“ des oströmischen Kaisers und weströmischer Bestandteil des imperium romanum sein. Dieses Streben nach Kontinuität findet auch Ausdruck in einem Rechtstext (Edictum Theodorici), den wahrscheinlich Theoderich hat aufzeichnen lassen (Nehlsen). Von den Ostgoten zu unterscheiden sind die Westgoten, die nicht im Kernland, sondern im ehemaligen weströmischen Provinzialland, dem römischen Gallien siedeln. Auf die rege Gesetzgebungstätigkeit der Westgoten ist noch zurückzukommen (5. Kapitel 2.1, S. 129).
In den germanischen Nachfolgestaaten gilt für die Rechtsunterworfenen römischer Herkunft weiterhin das römische Recht. Der Grund hierfür liegt im römischen Personalitätsprinzip. Wie bereits angedeutet, standen nach diesem Prinzip Nichtrömer (peregrini) unter ihrem Heimatrecht und blieben zu selbständiger Gesetzgebung und Rechtspflege befugt ( 2. Kapitel 4, S. 66.). Voraussetzung war lediglich, dass sie derselben [<<106] Nation angehörten. So wurden im römischen Reich lebende Athener nach athenischem Recht, Alexandriner nach alexandrinischem Recht beurteilt. Für römische Bürger galt das ius civile und für den Rechtsverkehr mit oder unter Peregrinen das ius gentium. Da nun die Nachfolgestaaten das Personalitätsprinzip auch nach Auflösung des weströmischen Reiches noch anerkannt haben, wurden Einwanderer auf dem ehemaligen römischen Territorium nach ihren Stammesrechten und die römische Bevölkerung nach römischem Recht beurteilt. Diese Tatsache hat sich für die Wirkungsgeschichte des römischen Rechts als überaus folgenreich erwiesen. Denn das Personalitätsprinzip verhalf dem römischen Recht dazu, auch nach dem Untergang des weströmischen Reichs innerhalb dieses Gebiets noch als geltendes Recht anerkannt zu werden. Die römische Rechtstradition lebte ferner in den Gesetzen der Germanen für die in den eroberten Gebieten lebenden Römer (Leges Romanae) sowie in den Germanenrechten selbst (Leges) weiter (S. 135).
Читать дальше