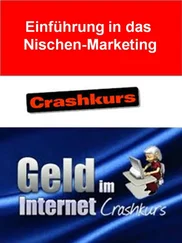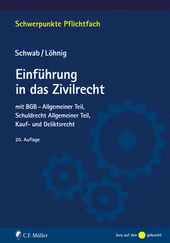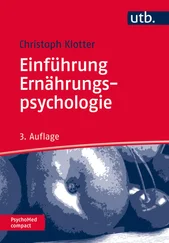Um einen ersten Überblick zu erleichtern, erfolgt an dieser Stelle im Rahmen dieses einführenden Beitrags eine Beschränkung auf die Posttraumatische Belastungsstörung als Traumafolgestörung, über die in diesem Bereich auch die fundiertesten Erkenntnisse vorliegen.
Zur Vertiefung liegen detaillierte Reviews aus jüngster Zeit vor:
Sherin & Nemeroff, 2011; Marinova & Maercker, 2015
Die wesentlichen, einer Posttraumatischen Belastungsstörung zuzuordnenden Veränderungen finden sich in den folgenden Bereichen:
 (neuro-) hormonale Effekte;
(neuro-) hormonale Effekte;
 funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) und Positronen-Emissionstomographie (PET);
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) und Positronen-Emissionstomographie (PET);
 (Epi-) Genetik.
(Epi-) Genetik.
(Neuro-)hormonale Veränderungen
Im Mittelpunkt (neuro-) hormonaler Veränderungen nach Traumatisierung stehen die Katecholamin- (insbesondere Noradrenalin) und die Cortisolregulation.
vermehrte Noradrenalinausschüttung
Es kommt zu einer Hoch-Regulation der Plasmaspiegel des Stresshormons Noradrenalin, die zu sekundären Folgen wie gesteigerter Wachsamkeit und Nervosität (Hypervigilanz), Impulsivität, erhöhtem Blutdruck (Hypertonie) und Herzrasen (Tachykardie) führen kann. Diese wiederum tragen zu einer erhöhten Häufigkeit von Herzerkrankungen bei der PTBS bei, letztlich auch zu einer erhöhten Sterblichkeit (Mortalität) im Langzeitverlauf (S3-Leitlinie PTBS; Flatten et al., 2011).
Hypocortisolismus
Demgegenüber wird die Ausscheidung von Cortisol unterdrückt (Hypocortisolismus), mit der Folge reaktiv erhöhter Level an Corticotropin Releasing Hormon (CRH). Da Cortisol die Noradrenalin-Ausscheidung hemmt, führt der Cortisol-Mangel dementsprechend zu einer ungezügelten Ausscheidung (Disinhibition) von Noradrenalin und verstärkt dessen negative Folgen.
Weitere Regelsysteme, die sich nach Traumatisierungen verändern, hier aber nicht detailliert wiedergegeben werden können, umfassen beispielsweise Dopamin, Serotonin, gamma-Aminobuttersäure (GABA), Glutamat, endogene Opioide und Neuropeptid Y.
Zum Teil existieren zu diesen Veränderungen widersprüchliche Befunde, die auch mit den untersuchten Patientengruppen und traumatischen Ereigniskategorien zusammenhängen können.
Veränderungen im fMRT und PET
Eine Reihe von Studien konnte strukturelle und funktionelle Veränderungen des Gehirns nach Traumatisierungen nachweisen, die sich u. a. in der (funktionellen) Magnetresonanztomographie (fMRT) und der Positronen-Emissionstomographie (PET) abbilden ließen.
Strukturell zeigten sich verminderte Volumina der Hippocampi, des linken Corpus amygdaloideum (Mandelkern) und anterioren cingulären Cortex sowie der linken Insel und des rechten Gyrus parahippocampalis (Meng et al., 2014).

Bahnbrechend für die neurobiologische Modellbildung waren Untersuchungen mithilfe der Positronen-Emissionstomographie. Hiernach war unter experimentell induzierten szenischen Erinnerungen an ein Trauma (Flashbacks) besonders das Broca-Areal (motorisches Sprachzentrum) in seiner Aktivität unterdrückt und die Mandelkernregion (Corpus amygdaloideum) der rechten Gehirnhälfte besonders aktiv (Kosslyn et al., 1996).
Diese Befunde decken sich mit dem klinischen Phänomen, dass viele Traumatisierte das Geschehen oft nur bildhaft wiedererleben, nicht in Worte fassen können und immer wieder von einem Zustand wortlosen Entsetzens („speachless terror“) ergriffen werden.

Parallel zu diesen Befunden waren im funktionellen MRT unter Reizexposition verminderte Aktivitäten des linken Hippocampus und Gyrus parahippocampalis auffällig. Diese Region ist an der emotionalen Bewertung und Einordnung eingehender (auch belastender) Sinneseindrücke beteiligt und damit für eine gesunde Reizverarbeitung unentbehrlich. Interessant war die Beobachtung, dass einige dieser Veränderungen unter kognitiv-behavioraler Stabilisierungsbehandlung im Gruppensetting rückläufig waren, also offenbar psychotherapeutisch beeinflussbar sind (Thomaes et al., 2012). Dieser Befund korrespondiert mit der Beobachtung, dass Patienten unter erfolgreicher Therapie trauma-bezogene Emotionen klarer wahrnehmen und benennen und dadurch die traumatische Erfahrung besser verstehen und in ihren Erlebnishorizont einordnen können.
(Epi-)genetische Dispositionen und Veränderungen
Bei trauma-assoziierten Erkrankungen stehen schon per definitionem Umweltfaktoren an erster Stelle der Pathogenese. Dennoch sind genetische Dispositionen Teil des Krankheitsgeschehens, vor allem Varianten (Polymorphismen) im genetischen Material der Gehirn-Botenstoffe (Neurotransmitter) Dopamin, Noradrenalin, Serotonin.
Dazu kommen umgekehrt aber auch genetische Veränderungen, die offenbar durch Traumafolgestörungen verursacht werden, zum Beispiel epigenetische Veränderungen im Methylierungsgrad von Glucocorticoid-Rezeptor-DNA und FKBP5-DNA (dieses Gen ist ein Modulator der Stresshormonachse und ist u. a. an der Entstehung von Depression beteiligt). Diese waren mit der Symptomschwere und Therapieprognose bei Kriegsveteranen assoziiert (Yehuda et al., 2013).
Die Erkenntnisse über die neurobiologischen Korrelate von Traumafolgestörungen sind in den vergangenen Jahren weit fortgeschritten. Sie sind deshalb von besonderer Bedeutung, da sie die Grundlage für Weiterentwicklungen in den Bereichen medikamentöser Behandlung, aber auch Früherkennung und Verlaufskontrolle von Traumafolgestörungen darstellen können.
1.8 Fragen zu Kapitel 1

1. Bitte definieren Sie die Disziplin „Psychotraumatologie“ inklusive der Beschreibung ihrer Ausdifferenzierungen.
2. Was versteht man unter einer „psychischen Traumatisierung“?
3. Bitte erläutern Sie den Begriff der „Kumulativen Traumatisierung“.
4. Skizzieren Sie einige zentrale traumahistorische Konzepte.
5. Wie wahrscheinlich ist die Ausbildung einer PTBS nach a) Vergewaltigung, b) bei Kriegs- und Folteropfern, c) bei Verkehrsunfallopfern? Haben Sie Erklärungen für die individuelle Spannbreite für die Entwicklung einer Traumafolgestörung?
6. Skizzieren Sie das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung nach Fischer und Riedesser.
7. Welche Schutzfaktoren stehen welchen Risikofaktoren gegenüber, die darüber entscheiden, ob ein Ereignis für eine Person traumatischen Charakter annimmt?
8. Nennen Sie drei Module, die in der Primärprävention psychischer Erkrankungen nach Traumatisierungen eingesetzt werden.
9. Auf welche Weise können Computer-basierte Angebote die konventionelle Stressprävention sinnvoll ergänzen?
10. Welche beiden (neuro-) hormonellen Systeme sind bei einer PTBS vor allem betroffen und wie?
11. Nennen Sie drei Areale des Gehirns, deren Funktion sich nach Traumatisierungen verändert.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше
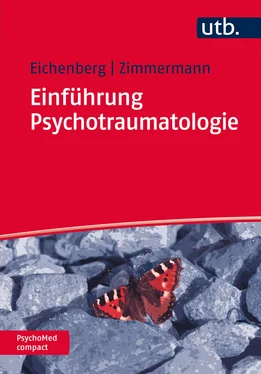
 (neuro-) hormonale Effekte;
(neuro-) hormonale Effekte;