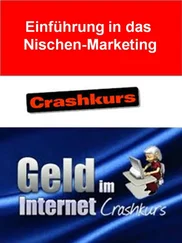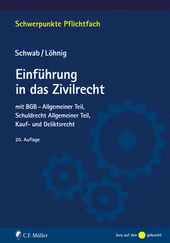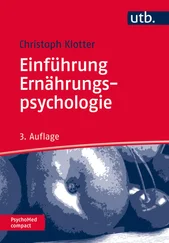Schutzfaktoren nach Egle et al. (1996, S. 19)
 eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson;
eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson;
 Aufwachsen in einer Großfamilie mit kompensatorischen Beziehungen zu den Großeltern und entsprechender Entlastung der Mutter;
Aufwachsen in einer Großfamilie mit kompensatorischen Beziehungen zu den Großeltern und entsprechender Entlastung der Mutter;
 ein gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust;
ein gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust;
 überdurchschnittliche Intelligenz;
überdurchschnittliche Intelligenz;
 ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament;
ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament;
 sicheres Bindungsverhalten;
sicheres Bindungsverhalten;
 soziale Förderung, z. B. durch Jugendgruppen, Schule oder Kirche;
soziale Förderung, z. B. durch Jugendgruppen, Schule oder Kirche;
 verlässlich unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter, vor allem Ehe- oder sonstige konstante Beziehungspartner;
verlässlich unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter, vor allem Ehe- oder sonstige konstante Beziehungspartner;
 lebenszeitlich späteres Eingehen „schwer lösbarer Bindungen“;
lebenszeitlich späteres Eingehen „schwer lösbarer Bindungen“;
 eine geringe Risiko-Gesamtbelastung.
eine geringe Risiko-Gesamtbelastung.
Risikofaktoren nach Egle et al. (1996, S. 19)
 niedriger sozioökonomischer Status der Herkunftsfamilie
niedriger sozioökonomischer Status der Herkunftsfamilie
 mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr;
mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr;
 schlechte Schulbildung der Eltern;
schlechte Schulbildung der Eltern;
 große Familien und sehr wenig Wohnraum;
große Familien und sehr wenig Wohnraum;
 Kontakte mit Einrichtungen der „sozialen Kontrolle“;
Kontakte mit Einrichtungen der „sozialen Kontrolle“;
 Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils;
Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils;
 chronische Disharmonie;
chronische Disharmonie;
 unsicheres Bindungsverhalten nach dem 12. / 18. Lebensmonat;
unsicheres Bindungsverhalten nach dem 12. / 18. Lebensmonat;
 psychische Störungen der Mutter oder des Vaters;
psychische Störungen der Mutter oder des Vaters;
 alleinerziehende Mutter;
alleinerziehende Mutter;
 autoritäres väterliches Verhalten;
autoritäres väterliches Verhalten;
 Verlust der Mutter;
Verlust der Mutter;
 häufig wechselnde frühe Beziehungen;
häufig wechselnde frühe Beziehungen;
 sexueller und / oder aggressiver Missbrauch;
sexueller und / oder aggressiver Missbrauch;
 schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen;
schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen;
 ein Altersabstand zum nächsten Geschwister von unter 18 Monaten;
ein Altersabstand zum nächsten Geschwister von unter 18 Monaten;
 uneheliche Geburt.
uneheliche Geburt.
In der traumatischen Situation ist Handeln dringend erforderlich, kann aber aufgrund der situativen Gegebenheiten nicht erfolgen; eine subjektiv angemessene Reaktion ist unmöglich. In bedrohlichen Stresssituationen versetzt das vegetative Nervensystem den Körper in einen Aktivierungszustand und bereitet ihn auf Reaktionen, die dem Selbstschutz dienen sollen, vor (Fischer & Riedesser, 2009; Herman, 2003). Diese Bereitstellungsreaktionen können als Triade von Kampf, Flucht oder Totstellreflex zusammengefasst werden (Bering, 2011). In der traumatischen Situation kann keine dieser akuten Reaktionstendenzen sinnvoll umgesetzt werden, es entsteht eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Handlung(-smöglichkeit); es kommt zu einer „unterbrochenen Handlung“.
traumatische Reaktion
Postexpositorisch stehen die Betroffenen dann vor der paradoxen Aufgabe, eine Erfahrung verarbeiten zu müssen, die ihre Verarbeitungskapazität überschreitet. Mit der traumatischen Reaktion versuchen sie, das Unfassliche dennoch zu fassen und zu überwinden. Die sich in dieser Phase zeigenden Beschwerden werden hierbei nicht als krankhaft angesehen, sondern als normale Reaktionen auf ein nicht normales, erlebtes Ereignis (sog. „Normalitätsprinzip“). Zur Verarbeitung des Erlebten muss das traumatische Erlebnis als singuläres Extremereignis der eigenen Lebensgeschichte begriffen werden, dessen Wiederholung zwar prinzipiell möglich, aber äußerst unwahrscheinlich ist.
Misslingt den Betroffenen die Integration des Traumas, geht die traumatische Reaktion nicht in die Erholungsphase, sondern in den traumatischen Prozess über. Die Symptome chronifizieren. Der traumatische Prozess ist gekennzeichnet durch den Versuch, mit einer unerträglichen Erfahrung zu leben, ohne sich mit ihr wirklich konfrontieren zu müssen.
In der postexpositorischen Phase findet somit eine Art Weichenstellung statt. Korrektive Umgebungsfaktoren können den Übergang in die Erholungsphase entscheidend erleichtern. Andererseits ist die postexpositorische Phase insgesamt als besonders vulnerabler Zeitabschnitt zu sehen, in dem schon vergleichsweise geringe zusätzliche Belastungen eine pathogene Entwicklung fördern können. Dem Umgang von Behörden und Helferpersonen mit Traumaopfern kommt hier eine besondere präventive Bedeutung zu (vgl. Eichenberg & Harm, 2008). Sie müssen geschult werden, sich sensibel auf den natürlichen Traumaverlauf und die vulnerable postexpositorische Zeit einzustellen und Hilfsmaßnahmen dem natürlichen Erlebnisverlauf und Verarbeitungsprozess der Betroffenen anzupassen.
Traumastörungen weisen insgesamt eine spezifische Pathogenese auf, die sich u. a. aus der Dynamik von Traumaschema und traumakompensatorischem System ergibt (ausführlich bei Fischer, 2007).
Читать дальше
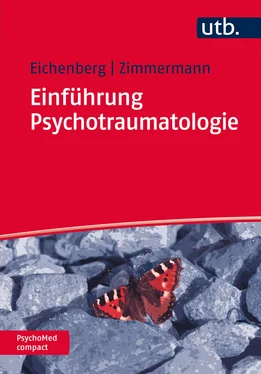
 eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson;
eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson;