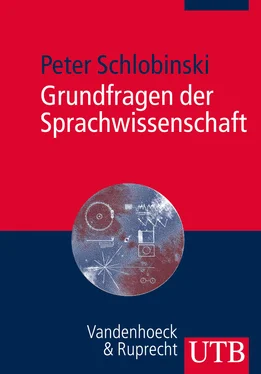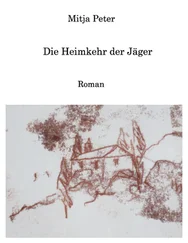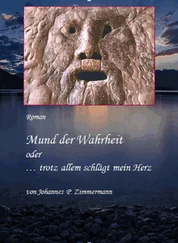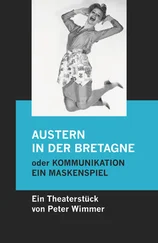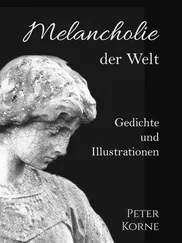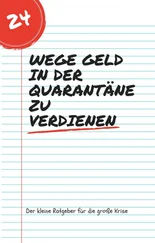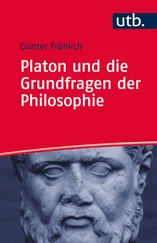16 Was haben Sprachen gemeinsam?
Worin sind Sprachen typischerweise gleich und worin unterscheiden sie sich? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt der so genannten Sprachtypologie. Der Begriff ›Sprachtypologie‹ geht zurück auf den Sprachwissenschaftler Georg von der Gabelentz (1840–1893), der mit seinem 1891 erschienenen Buch Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse wesentliche Grundlagen der allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft gelegt hat. In seinem Buch heißt es: »welcher Gewinn wäre es auch, wenn wir einer Sprache auf den Kopf zusagen dürften: Du hast das und das Einzelmerkmal, folglich hast du die und die weiteren Eigenschaften und den und den Gesamtcharakter! – wenn wir, wie es kühne Botaniker wohl versucht haben, aus dem Lindenblatte den Lindenbaum construiren könnten. Dürfte man ein ungeborenes Kind taufen, ich würde den Namen Typologie wählen« (Gabelentz 1984: 481). Was Gabelentz hier skizziert, ist ein Erkenntnisprinzip, demnach Eigenschaften einer Sprache so aufeinander bezogen sind, dass aus der einen Eigenschaft einer Sprache auf andere Eigenschaften derselben und dass aus einer Summe von Eigenschaften auf den Typ einer Sprache rückgeschlossen werden kann. Dahinter steckt die Idee, über Gemeinsamkeiten allgemeine Strukturen von Sprachen feststellen zu können. Solche allgemeinen Strukturen werden als sprachliche Universalien bezeichnet.
Unter den aus dem systematischen Vergleich von Sprachen ermittelten Universalien gibt es solche, die ausnahmslos und uneingeschränkt gelten, und solche, die nur partiell gelten. Man spricht von absoluten und relativen Universalien. Die Universalie ›Eine Sprache hat mindestens drei Vokale‹ gilt absolut. Für alle Sprachen gilt auch, dass sie den Silbentyp Konsonant-Vokal (z.B. dt. Vo-ka-le oder jap. na-ka-ma = Freund, Kamerad) aufweisen.
Ein anderes Beispiel ist die Wort- und Satzgliedstellung. Betrachtet man den einfachen Aussagesatz und prüft die Stellung von Subjekt (S) und Objekt (O) in Bezug zum Verb (V), so lassen sich zwei zentrale Stellungstypen finden, nämlich SVO und SOV:
| 1 |
Englisch (SVO) |
|
The man hit the ball. |
|
| 2 |
Japanisch (SOV) |
|
Taro-ga |
tegami-o |
kakimasu |
|
Name-Subj |
Brief-dO |
schreiben |
|
Taro schreibt einen Brief / Briefe. |
Nach verschiedenen Untersuchungen zeigt sich, dass die Sprachen der Welt zwischen 85 % und 90 % SOV oder SVO aufweisen, der erste Typ tritt dabei ein wenig häufiger auf. Die Stellungstypen VSO, VOS kommen demgegenüber selten, OVS und OSV extrem selten vor.
Eine kleine Nebenbemerkung zu den exzeptionellen Mustern OVS und OSV: In der Star-Wars-Saga weist der Jedi-Meister Yoda in seiner Sprache eine besondere Wortstellungsvariante auf. Yoda gehört zu einer nicht weiter bezeichneten Spezies, ist 66 cm groß und mehrere Jahrhunderte alt und hat zahlreiche Schüler im Gebrauch der ›Macht‹ ausgebildet. Seine Sprache ist durch eine stark markierte Wortstellung gekennzeichnet, nämlich OSV, z.B.: ›Ein seltsames Gesicht du machst.‹ Es ist der Stellungstyp, der in den Sprachen der Welt am seltensten vorkommt. Die Macher der Saga haben also (bewusst oder intuitiv) jene Stellungsvariante gewählt, die am stärksten vom Normalen abweicht. Dadurch wird das Fremde auch sprachlich markiert. Auch das Klingonische, eine voll ausgearbeitete fiktionale Sprache (Star Trek), hat eine stark markierte Wortstellung, nämlich OVS (3a, b).
| 3 |
|
Klingonisch (OVS) |
|
(a) |
puq |
legh |
yaS |
|
|
Kind |
3s.sieht.3s |
Offizier |
|
|
Der Offizier sieht das Kind. |
|
(b) |
yaS legh puq |
|
|
Das Kind sieht den Offizier. |
Das Deutsche stellt einen Mischtyp von SVO und SOV dar, genauer: Es gibt beide Muster in Abhängigkeit von der Satzstruktur. Zunächst ist zwischen Hauptsatz und Nebensatzstellung zu unterscheiden. Im Hauptsatz liegt SVO vor, z.B. Er betritt das Haus, im Nebensatz hingegen SOV Ich beobachte ihn, während er das Haus betritt. Ändert sich der Satzmodus, kann das Verb in Spitzenposition stehen, z.B. Betritt er das Haus? Das Subjekt steht aber in allen Fällen vor dem Objekt (wie bei 99 % aller Sprachen). Zudem kompliziert sich das Stellungsverhalten dadurch, dass das Deutsche die sog. Satzklammer bildet (s. hierzu Kap. 48).
Joseph Harold Greenberg (*28.5.1915 in New York; † 7.5.2001 in Stanford) Joseph Greenberg wurde am 28. Mai 1915 in Brooklyn geboren. Über die Musik kam er zur Sprachwissenschaft, bereits mit 14 Jahren gab er ein Klavierkonzert in der Steinway Hall. Er studierte an der Columbia University in New York, u.a. bei Franz Boas (1858–1942), und später an der Northwestern University in Chicago, wo er auch die Hausa-Sprache lernte. Nach der Dissertation studierte er in Yale, unterrichtete ab 1948 Anthropologie an der Columbia University und ab 1962 an der Stanford University.
Berühmt wurde Greenberg durch seine sprachtyplogischen Arbeiten, seine Arbeiten zur Sprachklassifikation und insbesondere durch sein 1966 erschienenes Buch Language Universals: With Special Reference to Feature Hierarchies. Roman Jakobson hat bereits 1963 die Bedeutung der Greenberg’schen Universalienforschung erkannt und hervorgehoben: »Auf der grammatischen Ebene ist J.H. Greenbergs Auflistung von 45 implikativen Universalien eine eindrucksvolle Leistung. […] diese Daten (bleiben) unschätzbare und unentbehrliche Voraussetzungen für eine neue Sprachtypologie und für eine systematische Übersicht der universalen Gesetze der grammatischen Schichtung« (Jakobson 1992: 499).
Neben rein statistisch verteilten Universalien und absoluten gibt es solche, die eine hierarchische Ordnung angeben, sie werden als implikative Universalien bezeichnet. Die Ordnungsrelation hat das Grundmuster ›Wenn A gilt, dann folgt daraus B‹. Hierunter fallen Aussagen wie ›Wenn eine Sprache einen Plural hat, dann hat sie einen Singular‹, ›Ein Genusunterschied beim Nomen impliziert einen Genusunterschied beim Pronomen‹ oder ›In Sprachen mit Präpositionen folgt fast immer die Genitivphrase der Nominalphrase‹, z.B. dt. das Buch des Lehrers. Dies gilt aber eben nicht immer, z.B. Peters Buch oder des Kaisers neue Kleider. Hier liegt eine präferierte, statistisch wahrscheinliche Implikation vor. Ein anderes Beispiel ist die folgende Korrelation von Wortstellungstyp und Präpositional-/Postpositionalgruppe. Sprachen mit VSO-Stellung sind fast immer präpositional (P-NGr, entspricht dt. entlang des Weges), Sprachen mit SOV-Stellung fast immer postpositional (NGr-P, entspricht dt. den Weg entlang). In der SOV-Sprache Japanisch steht naka (dt. in) nach dem Nomen: Biru no naka ›in dem Hochhaus‹. Es gibt auch semantische implikative Universalien: Eine Sprache, die die Farbbezeichnungen rosa oder orange hat, hat ebenso Bezeichnungen für braun, blau, grün, gelb und rot.
Der Gelehrte und Politiker James Harris (1709–1780) definiert in seinem erstmals 1751 erschienenen Buch Hermes, or a philosophical inquiry concerning language and universal grammar Universalgrammatik (universal grammar) als »that Grammar, which without regarding the several Idioms of particular Languages, only respects those Principles, that are essential to them all« (Harris 1771: 100). Dieser Satz könnte von Noam Chomsky stammen und wie Chomsky (s. Kap. 4) glaubt Harris, dass »MIND [is] ultimately the Cause of all« (ebd., S. 306). Universalien und Universalgrammatik sind in dieser Perspektive mental verankert, bei Chomsky sind es Prinzipien in der biologischen Grundausstattung des menschlichen Gehirns, bei Harris angeborene Ideen, die letztlich archetypische Formen des Geistes Gottes sind.
Читать дальше