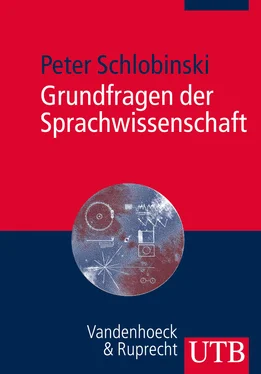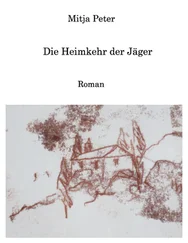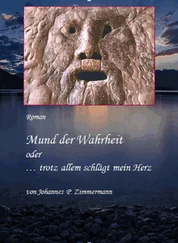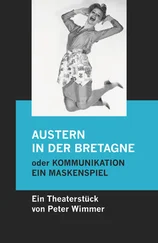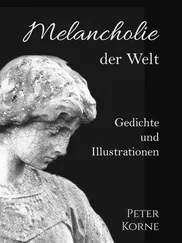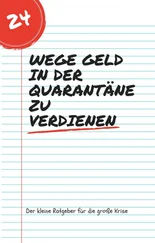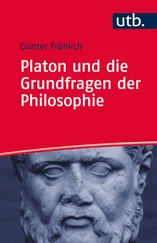Peter Schlobinski - Grundfragen der Sprachwissenschaft
Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Schlobinski - Grundfragen der Sprachwissenschaft» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Grundfragen der Sprachwissenschaft
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Grundfragen der Sprachwissenschaft: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Grundfragen der Sprachwissenschaft»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dem Autor gelingt der Spagat zwischen fachlicher Angemessenheit und Allgemeinverständlichkeit. So können auch Leser mit keinen oder geringen Vorkenntnissen die Welt der Sprachen entdecken.
Grundfragen der Sprachwissenschaft — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Grundfragen der Sprachwissenschaft», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Eine zweite Berühmtheit ist Sarah, die 130 Wortsymbole unterscheiden und diese auf einer Magnettafel zu sinnvollen Einheiten zusammensetzen konnte. Die Psychologen, die Sarah trainiert hatten, stellen fest: »Verglichen mit einem zweijährigen Kind kann Sarah sich in der Sprachfähigkeit durchaus behaupten« (Premack/Premack 1972: 430). Ein wesentlicher Einwand gegen Schlussfolgerungen dieser Art war jedoch die Tatsache, dass die Schimpansen in Experimenten und über Belohnungssysteme die Sprache antrainiert bekommen hatten, sie waren konditioniert. Dies wäre mit keinem natürlichen Spracherwerb wie bei Kindern vergleichbar. Und diese berechtigte Kritik relativiert die Ergebnisse in der Tat. Doch dann erscheint Anfang der 80er Jahre Kanzi auf der Bildfläche der Primatenforschung.
Kanzi, Sohn eines sprachtrainierten Bonoboweibchens namens Matata, kam im Alter von sechs Monaten mit graphischen Symbolen, Gesten und gesprochener Sprache in Kontakt. Anders als in den Vorgängerstudien wurde er jedoch nicht konditioniert, sondern es blieb bei Angeboten und Ermunterungen. Das Ergebnis war überraschend. Kanzi erwarb die Kompetenz, Einwort- und Mehrwortsätze zu produzieren, und ein Vergleich mit den rezeptiven sprachlichen Fähigkeiten eines zweijährigen Mädchens ergab Ähnlichkeiten (Savage-Rumbaugh et al. 1993). Savage-Rumbaugh, die Primatologin, die mit Kanzi arbeitete, zog daraus die Schlussfolgerung, dass wir unsere Sichtweise auf das »Lebewesen Affe revidieren müssen. Wenn Affen Sprache auf die gleiche Art wie Menschen – das heißt ohne besonderen Unterricht – erwerben können, dann bedeutete das, daß der Mensch keine einzigartige Form von Intelligenz besitzt, die sich grundlegend von der aller Tiere unterscheidet. Vielleicht war es für den Homo sapiens ein besonderes Geschehen, daß er sprachähnliche Laute hervorbringen oder Werkzeuge herstellen konnte, aber das bedeutet nicht, daß er die Dinge auf einer ganz anderen Ebene verstand als die übrigen Lebewesen« (Savage-Rumbaugh/Lewin 1995: 159).
Trotz Kanzis Sprachfähigkeiten besteht zwischen diesen und der menschlichen Sprachfähigkeit nicht nur ein gradueller, sondern ein qualitativer, kategorialer Unterschied. Aber dennoch: Das sprachliche Potenzial bei Affen lässt den Schluss zu, dass subhumane Primaten über protosprachliche Fähigkeiten verfügen. Diese können als ein wichtiger Aspekt der Sprachevolution und als Ausgangspunkt der Phylogenese der menschlichen Sprache gesehen werden.
13 Über den Ursprung der Sprache
Dass Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen habe, dies nachzuweisen war der Versuch des deutschen Pfarrers Johannes Peter Süßmilch (1707-1767) in seiner 1766 publizierten Schrift Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, in der academischen Versammlung vorgelesen und zum Druck übergeben. Ausgangspunkt seiner Argumentation bildet die Überlegung, dass die Sprache so vollkommen sei, dass nur der Schöpfer dieses Wunderwerk habe vollbringen können. Mit und seit der natur- und sprachwissenschaftlichen Betrachtung von Sprache wird nicht Gott als Schöpfer, sondern die Evolution als zentraler Entwicklungsfaktor von Sprachfähigkeit gesehen. In einer modernen Fassung lautet die evolutionstheoretische Hypothese wie folgt: »Social communication has been around for as long as animals have interacted and reproduced sexually. Vocal communication has been around at least as long as frogs have croaked out their mating calls in the night air. Linguistic communication was an afterthought, so to speak, a very recent and very idiosyncratic deviation from an ancient and well-established mode of communicating« (Deacon 1997: 52). Sprachentwicklung wird als ein Adaptions- und Selektionsprozess begriffen: »Instead of approximating an imaginary ideal of communicative power and efficiency, or following formulae derived from an alleged set of innate mental principles, language structures may simply reflect the selection pressures that have shaped their reproduction« (ebd. S. 111).
Es sind besondere Entwicklungsschritte, die in Zusammenhang mit der Sprachentwicklung, der Phylogenese von Sprache gesehen werden:
1. Die Vergrößerung des Gehirns auf 700 bis 1300 Kubikzentimeter beim Homo erectus gegenüber dem Homo habilis. Eine Hypothese lautet, dass die Sprachentwicklung die Ursache für das Gehirnwachstum sei, eine andere, dass das Gehirnwachstum Sprachentwicklung bedingt (vgl. Kap. 74), eine dritte, dass Gehirnwachstum und Sprachentwicklung interdependent verliefen.
2. Der Nachweis des motorischen Sprachzentrums (Broca-Zentrum) durch Endocraniumabdruck eines Homo-erectus-(Sinanthropus-)Schädels (Zhoukoudian).
3. Die Veränderung des Stimmtrakts, nämlich eines tief liegenden Kehlkopfs. Der Stimmtrakt des Steinheim-Menschen (vor 300 000 Jahren), so zeigt die Rekonstruktion, ist unserem heutigen sehr ähnlich. Damit sind gegenüber anderen Primaten alle Voraussetzungen für artikulierte Sprache gegeben.
4. Die Rückbildung der Kiefermuskulatur hat dazu beigetragen, dass »die für das Sprechen erforderlichen Bewegungen des Unterkiefers im Laufe der Evolution immer besser kontrolliert werden konnten« (Carroll 2008: 262).
5. Die Schimpansenforschung zeigt, dass auch andere Primaten über Sprachfähigkeit verfügen (s.u. und Kap. 12). Dieser Punkt ist besonders interessant, da in der Primatenforschung die Schnittstelle von menschlicher und nicht-menschlicher Sprachfähigkeit besonders gut untersucht werden kann und zahlreiche Ergebnisse aus empirischen Studien vorliegen.
Johann Gottfried von Herder (*25.8.1744 in Mohrungen, †18.12.1803 in Weimar)
Herder hat als Philosoph, Dichter und Übersetzer zusammen mit Goethe, Schiller und Wieland das ›Viergestirn‹ der Weimarer Klassik bildend, die deutsche Klassik und Romantik wesentlich beeinflusst, und er hat die deutsche Sprach- und Geschichtswissenschaft mit begründet.
Neben seinem Frühwerk Fragmente über die neuere deutsche Literatur (1766/67) und der 1773 herausgegebenen Sammlung programmatischer Schriften unter dem Titel Von deutscher Art und Kunst, die für die deutsche Literatur von großer Bedeutung waren, ist es seine Abhandlung Über den Ursprung der Sprache (1772), die für die Sprachwissenschaft paradigmenbildend war. Gegen Süßmilchs Position, die Sprache sei von Gott gegeben (s. Text), vertritt Herder die Meinung, dass »Gott durchaus für die Menschen keine Sprache erfunden [hat], sondern diese haben immer noch mit Würkung eigner Kräfte, nur unter höherer Veranstaltung, sich ihre Sprache finden müssen« (Herder 1772: 63). Vielmehr finde sich der Ursprung der Sprachen in den »wilden Tönen freier Organe« (ebd. S. 18), wie sie auch bei Tieren zu finden sind.
Was aber unterscheidet die menschliche Sprache von der tierischen Lautgebung? »Der Mensch, in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnenheit (Reflexion) zum erstenmal frei würkend, hat Sprache erfunden« (ebd. S. 52). Und: « − die Sprache ist erfunden! Eben so natürlich und dem Menschen nothwendig erfunden, als der Mensch ein Mensch war« (ebd. S. 56).
Der Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, vertritt die These, dass erste Formen menschlicher Kommunikation in Zeigegesten und in der Nachahmung liegen und dass Gesten von Affen »are the original font from which the richness and complexities of human communication and language have flowed« (Tomasello 2008: 55). Der symbolischen Kommunikation geht die gestische, deiktische Kommunikation voraus, und sie kann rückgebunden werden auf nichtmenschliche, gestische Kommunikation der höheren Primaten. Es gibt zwei grundsätzliche Typen von Affengesten: Intentionalitätsgesten, z.B. Arm-Heben, um das Spiel zu initiieren, und Aufmerksamkeitsgesten. Der kommunikative Akt von Affengesten ist der folgende: »check the attention of other > walk around as necessary > gesture > monitor the reaction of other > repeat or use another gesture« (ebd. S. 33). Während Intentionalitätsgesten eine soziale Intention ausdrücken im Sinne von ›Gestengeber (G) will, dass der Rezipient (R) die durch die Geste ritualisierte Bedeutung tut‹, drücken Aufmerksamkeitsgesten aus, dass G will, dass R etwas sieht, und dies hat möglicherweise die Bedeutung, dass G R etwas tun lassen will. Über die gestische Kommunikation hinaus, die auch für die menschliche Kommunikation basal ist – der Leser achte einmal darauf, wie oft er mit dem Finger auf etwas zeigt, um bestimmte Intentionen auszudrücken, z.B. beim Einkauf –, sind Affen in der Lage, mit Menschen symbolisch zu kommunizieren. Die Forschungen von Susan Savage-Rumbaugh zu Zwergschimpansen (Bonobos) zeigen (s. Kap. 12), dass diese einen Wortschatz von 150 Wörtern erwerben können und Wörter in Form von Bildsymbolen zu Zwei- und Dreiwortsätzen kombinieren können, und sie sind dabei kreativ. Bonobos also haben die Fähigkeit, einfache sprachliche Systeme zu lernen, sie entwickeln aber diese nicht spontan. Was unterscheidet qualitativ die Sprachfähigkeit des Menschen von anderen Primaten und anderen Tieren (Delfinen, Papageien)? Was sprachliche Kommunikation einzigartig macht, ist nach Tomasello die Fähigkeit der kooperativen Kommunikation, der Wir-Intentionalität. Sowohl Sprecher als auch Hörer wissen, dass sie die gleiche Konvention in der gleichen Art und Weise gebrauchen, sie (glauben zu) verfügen über ein gemeinsam geteiltes Wissen: A weiß, dass B weiß, dass A weiß, dass X. Wenn A B auffordert, Y zu tun, dann glaubt er zu wissen, dass B weiß, dass A weiß, was die Aufforderung umfasst. Und in Bezug auf das sprachliche Zeichensystem (s. hierzu Kap. 19) ist entscheidend der Übergang zur symbolischen Kommunikation, zur Kommunikation mit arbiträren Zeichen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Grundfragen der Sprachwissenschaft»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Grundfragen der Sprachwissenschaft» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Grundfragen der Sprachwissenschaft» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.