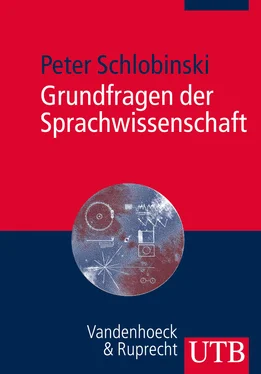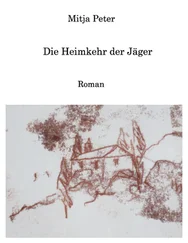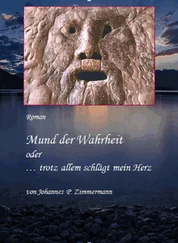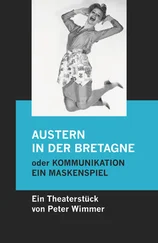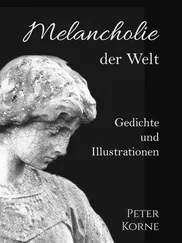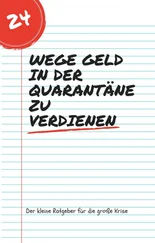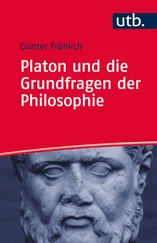| Sprachfamilie |
Sprachen |
Sprecherzahl (N in Mio.) |
Verbreitung |
| Indogermanisch |
220 |
3000 |
Europa, Südasien, heute weltweit |
| Sinotibetisch |
335 |
1288 |
China, Südostasien |
| Niger-Kongo |
1364 |
354 |
West-, Zentral-, Südafrika |
| Afroasiatisch |
311 |
347 |
Nordafrika, Naher Osten |
| Austronesisch |
1119 |
296 |
Taiwan, Philippinen, Indonesien, Pazifischer Ozean, Madagaskar |
| Dravidisch |
27 |
220 |
Süd, Zentral-, Nordindien, Pakistan |
| Turkisch |
37 |
160 |
West-, Zentralasien, Osteuropa, Sibirien |
| Japanisch-Ryukyu |
4 |
125 |
Japan, Okinawa |
Tab. 3: Sprachfamilien mit N > 100 Mio.
Die Ausdifferenzierung der heutigen Sprachen und Sprachfamilien ist maximal bis zu Beginn des Holozän (um 11 700 v. Chr.) rekonstruierbar, so meinen die einen, andere glauben, dass die untere zeitliche Grenze bei 8000 v. Chr. liegt. Allgemein wird angenommen, dass die Ausdifferenzierung der Sprachen auch in diesem Zeitraum liegt. Gemessen an dem Alter der Sprache des Homo sapiens (s. Kap. 13) ist dies eine vergleichsweise junge Entwicklung. Am besten untersucht ist die indoeuropäische Sprachfamilie, die auch zugleich mit 3 Milliarden Sprechern die meistverbreitete Sprachfamilie ist. Auf der Basis sprachwissenschaftlicher, archäologischer, historischer und genetischer Untersuchungen wird angenommen, dass sich die erste Aufspaltung des Proto-Indoeuropäischen vor maximal 9500 Jahren vollzog.
August Schleicher (*19.2.1821 in Meiningen, †6.12.1868 in Jena)
August Schleicher wurde im thüringischen Meiningen geboren und studierte zunächst einige Semester Theologie und anschließend orientalische Sprachen, wobei er auch Hebräisch, Sanskrit, Arabisch und Persisch erlernte. Er promovierte und habilitierte in Bonn und wurde dort Privatdozent, bis er 1850 eine Professur für klassische Philologie und Literatur in Prag erhielt. Von 1857–1868 hatte er eine Professur für deutsche und vergleichenden Sprachwissenschaft und des Sanskrit in Jena inne, wo er am 6. Dezember 1868 verstarb.
Schleicher zählt zu den Mitbegründern der Indogermanistik und gilt als Vater der sog. Stammbaumtheorie in der vergleichenden Sprachwissenschaft. Aufgrund von Sprachvergleichung und parallel zur Evolutionstheorie in der Biologie rekonstruiert er die Sprachen der indoeuropäischen Sprachfamilie in Form eines Abstammungsbaumes. Die Ergebnisse finden sich in seinem 1861 publizierten berühmten Werk Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. In der Einleitung heißt es: Die Methodik der Sprachwissenschaft »ist im wesentlichen die der naturwißenschaften überhaupt; sie besteht in genauer beobachtung des objectes und in schlüßen, welche auf die beobachtung gebaut sind. Eine der hauptaufgaben der glottik [Sprachwissenschaft, P.S.] ist die ermittelung und beschreibung der sprachlichen sippen und sprachstämme, d.h. der von einer und der selben ursprache ab stammenden sprachen und die anordnung dieser sippen nach einem natürlichen systeme« (Schleicher 1961: 2). Interessant, wenn auch heute (zu) wenig beachtet, ist sein 1873 erschienenes Werk Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft.
Die Komponenten indo- und -europäisch in der Bezeichnung der Sprachfamilie als indoeuropäisch oder auch indogermanisch deuten auf das Verbreitungsgebiet hin: die indische Gruppe im Osten und die europäische/germanische im Westen. Bereits 1786 wies der Indologe William Jones (1746–1794) Ähnlichkeiten des Sanskrit (Altindisch, hervorgegangen aus der Sprache der Veden) mit Griechisch und Latein nach. Das deutsche Wort ›Mutter‹ ist altindisch ma:tár-, gr. mé:te:r, lat. ma:ter. Als indoeuropäische Wurzel wird *ma:tér- angesetzt – der * gibt an, dass es sich um eine rekonstruierte Protoform handelt. Die Farbbezeichnung ›rot‹ geht zurück auf idg. *roudh-/ *rudh-. Aufgrund bestimmter lautlicher Merkmale wird die indoeuropäische Sprachfamilie traditionell in zwei Sprachzweige aufgeteilt, die Kentum- und die Satemsprachen nach (lat. centum und altiranisch satem für ›hundert‹), eine Unterteilung, die heute höchst umstritten ist. Zu den Satemsprachen sollen neben einer Reihe von indischen, iranischen und slawischen Sprachen die baltischen Sprachen, das Albanische und Armenische, zu den Kentumsprachen die germanischen Sprachen, keltische, italische Sprachen, Griechisch, Anatolisch, Tocharisch gehören.
Das Deutsche gehört wie das Englische und Niederländische zu den westgermanischen Sprachen. Man nimmt aufgrund vergleichender Studien an, dass das heute nicht mehr existierende Tocharische sich vor knapp 8000 Jahren abgespalten hat, das Griechisch-Armenische vor 7300 Jahren, das Albanisch-Persisch-Indische vor 7000 Jahren, das Keltische vor 6000 Jahren und das Italische und Germanische vor 5500 Jahren. Die Spaltungsprozesse hängen mit Migrationsbewegungen von Populationen zusammen und diese wiederum mit ökologischen (z.B. Klimaänderungen), ökonomischen und sozialen Veränderungen, insbesondere Ausbreitung der Landwirtschaft. Wie die indoeuropäischen Sprachen die alteuropäischen Sprachen (Baskisch ist eine solche, s.u.) ablösten, darauf gibt es bisher keine klare Antwort, weder seitens der Archäologie noch seitens der Paläogenetik und Linguistik. Aber die Herkunft scheint geklärt: Nach neuesten Forschungen sind Bauern aus Anatolien für den Sprachimport in Europa verantwortlich, sie brachten zusammen mit der Landwirtschaft und bäuerlichen Lebensweisen ihre Sprache aus Anatolien mit.
Der europäische Raum ist indoeuropäisch, wenn wir von Zuwanderersprachen wie Türkisch etc. absehen, doch eine Sprache hat der indoeuropäischen Invasion getrotzt: das Baskische. Auf der Basis von Genom-Untersuchungen kommt der Humangenetiker Cavalli-Sforza zu dem Schluss: »Die baskische Region erstreckte sich vormals (im Paläolithikum) fast auf das ganze Gebiet, in dem man die großen Felsmalereien und -skulpturen gefunden hat. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die baskische Sprache von den Sprachen abstammt, die die modernen Cro-Magnon-Menschen (vor fünfunddreißig- bis vierzigtausend Jahren) bei ihrem ersten Eindringen in Südfrankreich und Nordostspanien gesprochen haben, und daß die großen Künstler der Grotten in der Region eine von den ersten Europäern herkommende Sprache redeten, aus der sich das moderne Baskisch ableitet« (Cavalli-Sforza 2001: 135 f.). Das Baskische, das sich in seiner linguistischen Struktur von den anderen indoeuropäischen Sprachen deutlich unterscheidet (z.B. kein Genussystem), ist das Überbleibsel einer vor-indoeuropäischen Sprachfamilie, dem Vaskonischen, das seine sprachlichen Spuren in topografischen Bezeichnungen (Flüsse, Berge, Täler und Siedlungen) hinterlassen hat. Ein heiß diskutierter Fall ist die Städtebezeichnung München, die üblicherweise von lat. monachus ›Mönch‹ bzw. ital. monaco, mhd. munich abgeleitet und, da in der ersten urkundlichen Erwähnung apud Munichen steht, mit ›bei den Mönchen‹ interpretiert wird; im Stadtwappen von München ist schließlich auch ein Mönch abgebildet. Der Sprachwissenschaftler Theo Vennemann ist jedoch anderer Meinung, was in der Münchner Presse für große Aufregung sorgte: mun- bedeutet im heutigen Baskisch ›Ufer, Böschung, Bodenerhebung‹, -ic- ›Örtlichkeit‹ und -a drückt den bestimmten Artikel aus. Die Zusammensetzung ergäbe deshalb die Lesart ›der Ort auf der Uferterrasse‹, und das ursprüngliche München befand sich auf einer Uferterrasse (vgl. Vennemann 1997).
Das Baskische ist eine im indoeuropäischen Sprachengebiet isolierte Sprache, aber sie ist heute nicht isoliert von romanischen Sprachen, im Baskenland herrscht Mehrsprachigkeit. Das Spanische und Französische als Kontaktsprachen haben das moderne Baskisch erheblich beeinflusst, sodass Interferenzen, Entlehnungen, bestimmte Reduktionen usw. zu beobachten sind. Sprachkontakt ist eine zentrale Konstante in der Entwicklung der Sprachen (s. auch Kap. 70).
Читать дальше