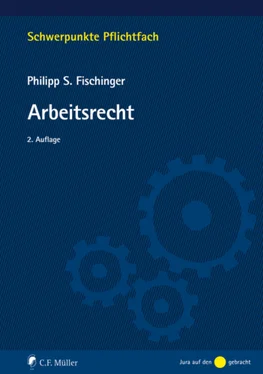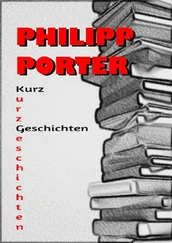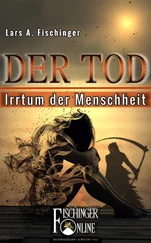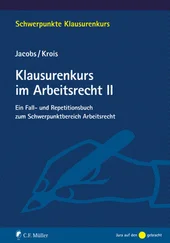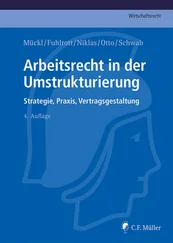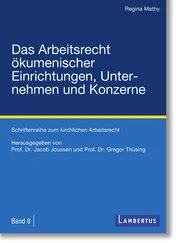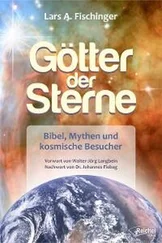1. Geschädigter: Arbeitskollege, § 105 I SGB VII
2. Geschädigter: Unternehmer, § 105 II SGB VII
3. Haftung anderer Personen, § 106 SGB VII
VI. Schädigung betriebsfremder Dritter
E. Mankohaftung
I. Begriff und Differenzierung
II.Gesetzliche Mankohaftung
1. Anspruchsgrundlage
2. Anspruchsinhalt und -begrenzung
III.Vertragliche Mankohaftung
1. Hintergrund
2. Zulässigkeit und Grenzen
F. Haftung bei Nichterfüllung der Arbeitspflicht
G. Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Beweislastverteilung
I. Hintergrund
II. Anwendungsbereich
III. Rechtsfolgen
§ 12 Beendigung von Arbeitsverhältnissen
A. Grundlagen
I. Beendigungsarten
II. Prüfungsreihenfolge
III. Erscheinungsformen von Kündigungen
B. Ordentliche Kündigung
I.Kündigungserklärung
1. Allgemeines
2. Zugang
3. Schriftform
4. Vertretung
II.Wahrung der Ausschlussfrist, §§ 4 S. 1, 7 KSchG
1. Allgemeines
2. Anwendungsbereich
3. Fristbeginn, -berechnung und -wahrung
4.Schutz des Arbeitnehmers
a) § 4 S. 4 KSchG
b) § 5 KSchG
c) § 6 KSchG
III.Betriebsratsanhörung, § 102 I BetrVG
1. Grundlagen
2. Anwendungsbereich
3. Unterrichtung
4. Rechte und Möglichkeiten des Betriebsrats
5. Folgen der (nicht) ordnungsgemäßen Anhörung
6. Nachschieben von Kündigungsgründen?
IV. Besonderer Kündigungsschutz
1. Grundsätze
2. Das Kündigungsverbot des § 17 MuSchG
a) Voraussetzungen
b) Rechtsfolgen
c) Darlegungs- und Beweislast
3. Kündigungsschutz während Elternzeit, § 18 BEEG
4. Kündigungsschutz während Pflegezeit, § 5 PflegeZG
5.Kündigungsschutz für Schwerbehinderte
a) Systematik und Anwendungsbereich
b) Zustimmung des Integrationsamts, §§ 168 ff. SGB IX
c) Anhörung der Schwerbehindertenvertretung, § 178 II 1, 3 SGB IX
6. Verstoß gegen das AGG
7. Schutz Auszubildender, § 22 BBiG
8. Weitere Vorschriften
a) Schutz von Arbeitnehmervertretern, § 15 KSchG, § 103 BetrVG
b) Schutz bei Massenentlassungen, §§ 17, 18 KSchG
c) Schutz von Datenschutzbeauftragten, §§ 6 IV 2, 38 II BDSG
d) Schutz bei Betriebsübergängen, § 613a IV BGB
e) Schutz der Koalitionsfreiheit, Art. 9 III GG
f) Verstoß gegen Maßregelungsverbote
g) Abgeordnete
9. Tabellarische Übersicht besonderer Kündigungsschutz
V. Allgemeiner Kündigungsschutz nach dem KSchG
1. Grundlagen
2. Anwendbarkeit des KSchG
a) Räumlicher Anwendungsbereich
b) Betrieblicher Anwendungsbereich, § 23 I KSchG
c) Persönlicher Anwendungsbereich
d) Sachlicher Anwendungsbereich
3. Systematik und Prinzipien
4.Personenbedingte Kündigung, § 1 II 1 Alt. 1 KSchG
a) Grundlagen
b) Prüfungsaufbau
c) Die wichtigsten Fallgruppen
d) Abgrenzung zur verhaltensbedingten Kündigung
5.Verhaltensbedingte Kündigung, § 1 II 1 Alt. 2 KSchG
a) Grundlagen
b) 1. Stufe: Verhaltensbedingter Grund „an sich“
c) 2. Stufe: Negativprognose
d) 3. Stufe: Ultima-ratio-Grundsatz
e) 4. Stufe: Interessenabwägung
6.Betriebsbedingte Kündigung, § 1 II 1 Alt. 3 KSchG
a) Grundlagen
b) 1. Stufe: Betriebliches Erfordernis
c) 2. Stufe: Ultima-ratio-Grundsatz („dringende“)
d) 3. Stufe: Sozialauswahl, § 1 III KSchG
e) Exkurs: Abfindungsanspruch nach § 1a KSchG
7.Prozessuale Hinweise
a) Darlegungs- und Beweislast
b) Entscheidungsmöglichkeiten des Gerichts
c) Auflösungsantrag, §§ 9, 10 KSchG
VI. Kündigungsschutz über §§ 138, 242 BGB
VII. Kündigungsfristen
1. Grundlagen
2.Gesetzliche Kündigungsfristen
a) Grundsatz: Vier Wochen, § 622 I BGB
b) Verlängerung der Kündigungsfristen für den Arbeitgeber, § 622 II BGB
c) Verkürzung bei vereinbarter Probezeit, § 622 III BGB
3.Vertragliche Änderungen
a) Durch Tarifvertrag, § 622 IV BGB
b) Im Arbeitsvertrag, § 622 V BGB
4. Sonderkündigungsfristen
5. Rechtsfolgen bei Missachtung der Kündigungsfrist
VIII. Vereinbarter Kündigungsschutz
IX. Prüfungsschema (am Beispiel einer ordentlichen verhaltensbedingten Kündigung)
C. Außerordentliche Kündigung
I. Grundlagen
II. Kündigungserklärung, § 623 BGB
III.Kündigungserklärungsfrist, § 626 II BGB
1. Allgemeines
2. Fristbeginn und -lauf
3. Rechtsfolgen
IV.Wichtiger Grund, § 626 I BGB
1. Allgemeines
2. 1. Stufe: Wichtiger Grund an sich
3.2. Stufe: Umfassende Interessenabwägung
a) Grundlagen
b) Ultima-ratio-Grundsatz
c) Interessenabwägung i.e.S. bzw. Sozialauswahl
V. Außerordentliche Kündigung durch den Arbeitnehmer
VI. Die speziellen Rechtsfolgen des § 628 BGB
VII. Prozessuale Hinweise
VIII. Prüfungsschema: Außerordentliche Kündigung
D. Sonderfall 1: Verdachtskündigung
I. Charakteristika
II. Voraussetzungen
III. Besonderheiten bei der Kündigungserklärungsfrist (§ 626 II BGB)
E. Sonderfall 2: Druckkündigung
F. Einschub: Wiedereinstellungsanspruch
G. Aufhebungsvertrag
I. Begriff und Abgrenzungen
II. Vor- und Nachteile von Aufhebungsverträgen
III. Grundsätzliche Zulässigkeit und Zustandekommen
IV.Wirksamkeit und Lösungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers
1. Sittenwidrigkeit, § 138 I BGB
2. Inhaltskontrolle anhand der §§ 307 ff. BGB
3. Anfechtbarkeit des Aufhebungsvertrags
4. Keine Widerrufbarkeit nach §§ 312b I 1 Nr. 1, 312g I BGB
5. Verletzung des „Gebot fairen Verhandelns“
6. Rücktritt vom Aufhebungsvertrag und Störung der Geschäftsgrundlage
V. Informationspflichten des Arbeitgebers
H. Tod einer Vertragspartei
I. Tod des Arbeitnehmers
II. Tod des Arbeitgebers
I. Rechtsfragen bei/nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
I. Freizeit zur Stellensuche, § 629 BGB
II. Hinweispflicht, § 2 II Nr. 3 SGB III
III. Zeugnisanspruch, §§ 630 S. 4 BGB, 109 GewO
IV. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
V. Sonstige nachvertragliche Pflichten
§ 13 Befristung von Arbeitsverhältnissen
A. Grundlagen
B. Begriff der Befristung und vorrangige Spezialregelungen
C. Anforderungen an wirksame Befristungen
I.Formelle Voraussetzung: Schriftform, § 14 IV TzBfG
1. Grundsätze
2. Heilung?
II.Materielle Voraussetzungen
1. Grundsatz: Sachgrunderfordernis
2.Ausnahme 1: Befristung bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren
a) Grundsatz, § 14 II 1 Hs. 1 TzBfG
b) Verlängerungsmöglichkeiten, § 14 II 1 Hs. 2 TzBfG
c) Rückausnahme: Anschlussverbot, § 14 II 2 TzBfG
3. Ausnahme 2: Gründerprivileg, § 14 IIa TzBfG
4. Ausnahme 3: Befristung älterer Arbeitnehmer, § 14 III TzBfG
5. Befristung mit Sachgrund, § 14 I TzBfG
a) Allgemeines
b) Benannte Sachgründe, § 14 I 2 TzBfG
c) Unbenannte (sonstige) Sachgründe
D. Rechtsfolgen einer wirksamen Befristung
I. Schutz des befristet Beschäftigten
II. Kündbarkeit, § 15 III TzBfG
III. Beendigung, § 15 I, II TzBfG
IV. Verlängerung, § 15 V TzBfG
E. Rechtsfolgen einer unwirksamen Befristung
I. Materieller Fehler
II. Mangel der Schriftform
III. Gerichtliche Geltendmachung, § 17 TzBfG
F. Darlegungs- und Beweislast
G. Prüfungsschema: Wirksamkeit einer Befristungsabrede
H. Auflösende Bedingung
I. Sonderfall: Altersgrenzen
§ 14 Änderung von Arbeitsbedingungen (Änderungskündigung)
A. Grundlagen
B. Die Änderungskündigung
I. Charakteristika
Читать дальше