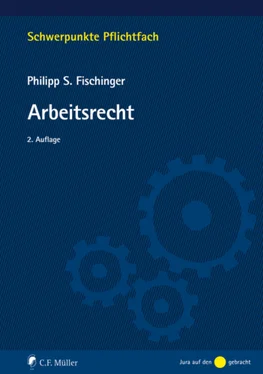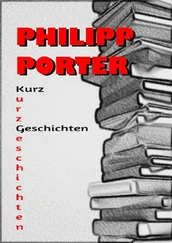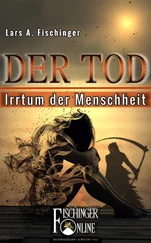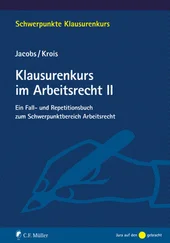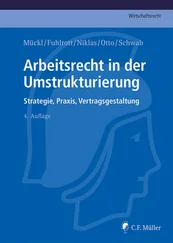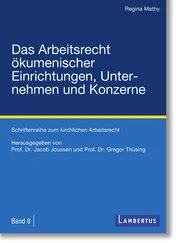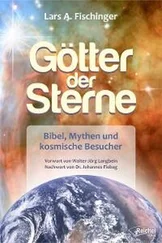3. Ausgestaltung des Anspruchs
4. Stichtagsklausel
5. Rückzahlungsvorbehalt
III.Aus-/Fortbildungsbeihilfen und Rückzahlungsklauseln
1. Grundlagen
2. Zulässigkeit der Rückzahlungsverpflichtung
3. Rechtsfolgen
F. Zulagen
G. Lohnanspruch trotz Nichterbringung der Arbeitsleistung
I. Grundsatz: „Ohne Arbeit kein Lohn“
II.Annahmeverzug, § 615 S. 1 BGB
1. Grundlagen und Abgrenzung zu § 326 II 1 BGB
2.Voraussetzungen
a) Bestehendes Arbeitsverhältnis
b) Angebot der vertragsmäßigen Arbeitsleistung
c) Nichtannahme
d) Leistungsfähigkeit
e) Leistungswilligkeit
3.Rechtsfolgen des Annahmeverzugs
a) Annahmeverzugslohn, § 615 S. 1 BGB
b) Anrechnung, § 615 S. 2 BGB
c) Keine Nacharbeitspflicht, § 615 S. 1 BGB
d) Darlegungs- und Beweislast
4. Beendigung des Annahmeverzugs
5. Abdingbarkeit
6. Prüfungsschema: Anspruch auf Annahmeverzugslohn, § 615 S. 1 BGB
III.Lohnzahlungspflicht bei Betriebsrisiko (§ 615 S. 3 BGB)
1. Betriebsrisiko
2. Abgrenzungen
3. Verhältnis von § 615 S. 3 BGB zu § 326 II 1 Alt. 1 BGB
IV.Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, § 3 EFZG
1. Grundlagen
2.Voraussetzungen
a) Persönlicher Anwendungsbereich
b) Erfüllung der Wartezeit, § 3 III EFZG
c) Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
d) Monokausalität
e) Kein Verschulden
f) Kein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers, § 7 EFZG
3.Rechtsfolgen
a) Höhe der Entgeltfortzahlung
b) Dauer der Entgeltfortzahlung
c) Weitere Rechtsfolgen
4. Darlegungs- und Beweislast
5. Weitere Fälle
6. Prüfungsschema: Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3 I EFZG
V.Entgeltzahlung an Feiertagen, § 2 EFZG
1. Normzweck
2. Voraussetzungen
3. Rechtsfolgen
4. Prüfungsschema: Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus § 2 I EFZG
VI.Vorübergehende Verhinderung, § 616 BGB
1. Normcharakter und -zweck
2.Voraussetzungen
a) Persönlicher Verhinderungsgrund
b) Kausalität
c) Zeitliche Begrenzung
d) Kein Verschulden
3. Rechtsfolgen
4. Prüfungsschema: Lohnanspruch trotz vorübergehender Verhinderung, § 616 BGB
§ 8 Hauptpflicht des Arbeitnehmers: Arbeitsleistung
A. Pflicht zur Arbeitsleistung
I. Synallagmatische Hauptleistungspflicht
II. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers
III. Gläubiger und Schuldner
IV. Art der Arbeitsleistung
V. Maß der Arbeitsleistung
VI. Ort der Arbeitsleistung
VII. Zeit der Arbeitsleistung
1. Öffentlich-rechtlicher Arbeitszeitschutz
2. Umfang der Arbeitsleistung
3. Zeitliche Lage
4. Teilzeitarbeit
B. Leistungsstörungen und ihre Sanktionierung
I.Nichterfüllung der Arbeitspflicht
1. Grundlagen
2. Entschädigung nach § 61 II ArbGG
3.Vertragsstrafe
a) Begriff und Abgrenzungen
b) Zulässigkeit von Vertragsstrafen
c) Rechtsfolgen von Verstößen
II. Schlechterfüllung
C. Befreiung von der Pflicht zur Arbeitsleistung
I. Unmöglichkeit der Leistungserbringung, § 275 I BGB
II.Leistungsverweigerungsrechte des Arbeitnehmers
1. Grundlagen
2. Persönliche Unzumutbarkeit, § 275 III BGB
3. Sonstige Leistungsverweigerungsrechte
III. Freistellung zur Pflege naher Angehöriger
IV. Wegfall der Beschäftigungspflicht nach MuSchG und BEEG
V. Weitere Fälle
D. Erholungsurlaub nach dem BUrlG
I. Begriff und Abgrenzungen
II. Voraussetzungen des Anspruchs auf Urlaubsgewährung
III. Urlaubserteilung, § 7 I, II BUrlG
IV. Umfang des Anspruchs auf Urlaubsgewährung
V.Erlöschen des Anspruchs auf Urlaubsgewährung
1. Erfüllung
2.Erlöschen nach § 7 III BUrlG
a) Grundlagen
b) Traditionell: Schadensersatzlösung
c) Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers
d) Besonderheiten bei dauerhafter krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
e) Zusammenfassung
VI. Sicherung des Urlaubszwecks, §§ 8-10 BUrlG
VII. Unabdingbarkeit, Unabtretbarkeit, Unpfändbarkeit
VIII. Urlaubsentgelt, § 11 BUrlG
IX.Urlaubsabgeltung
1. Grundsatz
2. Ausnahme: § 7 IV BUrlG
§ 9 Nebenpflichten des Arbeitgebers
A. Dogmatische Grundlage
B. Beschäftigungspflicht
I.Beschäftigungspflicht im laufenden Arbeitsverhältnis
1. Anspruchsinhalt
2. Schranken
3. Rechtsfolge bei Verletzung
II. Weiterbeschäftigung nach Ablauf der Kündigungsfrist bzw. nach außerordentlicher fristloser Kündigung
1. Weiterbeschäftigungspflicht nach § 102 V BetrVG
2. Allgemeine Weiterbeschäftigungspflicht
C. Pflicht zum Aufwendungsersatz
I. Grundlagen
II.Anspruchsvoraussetzungen
1. Aufwendung
2. Erforderlichkeit
3. Eigenschäden des Arbeitnehmers
4. Keine Vorab-/Pauschalvergütung
III. Rechtsfolgen
IV. Kürzung wegen Mitverschuldens
D. Pflicht zum Schutz der Rechtsgüter des Arbeitnehmers
I. Leben und Gesundheit
II. Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers
III. Eigentums- und Vermögensschutz
E. Maßregelungsverbote (insb. § 612a BGB)
§ 10 Nebenpflichten des Arbeitnehmers
A. Dogmatische Grundlage
B. Pflicht zur Unterlassung von Wettbewerb
I. Laufendes Arbeitsverhältnis
II. Beendetes Arbeitsverhältnis (nachvertragliches Wettbewerbsverbot)
C. Nebentätigkeiten
D. Verschwiegenheitspflicht
I. Schutz nach dem GeschGehG
II. Verschwiegenheitspflicht nach tradierten Grundsätzen
1. Laufendes Arbeitsverhältnis
2. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
E. Schmiergeldverbot
F. Herausgabepflichten und Recht am Arbeitserzeugnis
G. Sonstige Nebenpflichten
§ 11 Haftungsbesonderheiten im Arbeitsleben
A. Einleitung
B. Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung bei Sachschäden
I. Ausgangslage: Das zivilrechtliche Haftungssystem
II. Entwicklung der Lehre von der beschränkten Arbeitnehmerhaftung
III. Dogmatische Begründung und methodische Verortung
IV. Anwendungsbereich der privilegierten Arbeitnehmerhaftung
1. Haftungsprivilegierter
2. Persönlicher Anwendungsbereich auf Geschädigtenseite
3. Sachlicher Anwendungsbereich: Betrieblich veranlasste Tätigkeiten
V.Inhalt der Haftungsprivilegierung: Rechtsfolgenmodifikation per Schadensfolgenaufteilung
1. Grundlagen
2.Haftungsstufen
a) Vorsatz
b) Grobe Fahrlässigkeit
c) Mittlere Fahrlässigkeit
d) Leichteste Fahrlässigkeit
3. Folgen
VI.Besonderheiten bei der Schädigung von Kollegen/Dritten
1. Problemstellung
2. Methodische Umsetzung
a) Bestehen eines Gesamtschuldverhältnisses
b) Kein Gesamtschuldverhältnis
3. Zusammenfassung; Insolvenz des Arbeitgebers
VII. Zwingender Charakter
VIII.Prüfungsschemata
1. Schädigung des Arbeitgebers
2. Schädigung eines Kollegen/betriebsfremden Dritten
C. Haftung des Arbeitgebers bei Sachschäden
D. Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz bei Personenschäden, §§ 104 ff. SGB VII
I. Einführung
II. Überblick
III.Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen am Beispiel des § 104 SGB VII
1.Voraussetzungen
a) Versicherter
b) Für Unternehmen tätig/sonstige Versicherung begründende Beziehung
c) Unternehmer als Haftungsprivilegierter
d) Versicherungsfall
e) Kein Ausschluss
2.Rechtsfolgen
a) Ausschluss von Ansprüchen auf Ersatz von Personenschäden
b) Regress des Unfallversicherungsträgers beim Schädiger
IV. Prüfungsschema
V. Hinweise zu den §§ 105, 106 SGB VII
Читать дальше