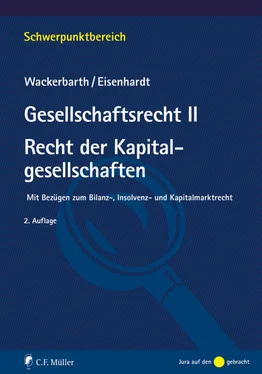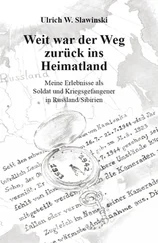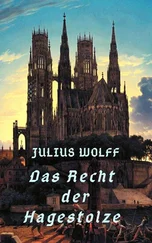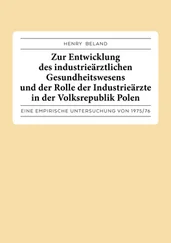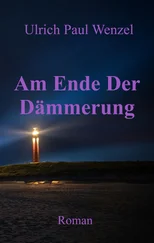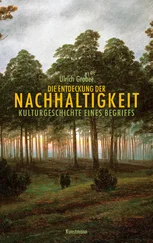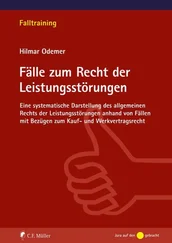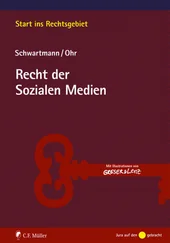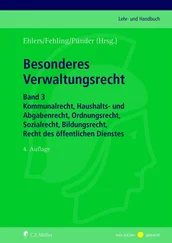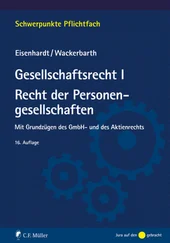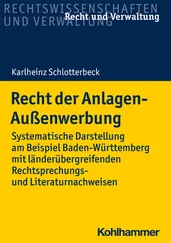292
cc) Es gibt noch ein systematisches Argument. Das bisherige System ist nämlich nicht widerspruchsfrei: Die Gesellschafter können nach den bisherigen Regeln auch nach dem Zeitpunkt Z2 weiterwirtschaften. Niemand kann ihnen jedoch verbieten, irgendwann zwischen dem Zeitpunkt Jahr 4 und Jahr 5 einen Liquidationsbeschluss zu fassen. Wenn sie dann während der Liquidation „feststellen“, dass die Gläubiger nicht befriedigt werden können, kann niemand mehr etwas dagegen tun. Das bisherige System leistet also dem Betrug zulasten der Gläubiger Vorschub bzw. legalisiert ihn. Das kann nicht richtig sein.
3. Konsequenzen für die Auslegung des seit Oktober 2008 geltenden § 19 Abs. 2 InsO
293
Nach dem unter 2. Gesagten ist richtiger Zeitpunkt für die Antragspflicht Z2. Nach dem bisherigem Recht wurde allerdings von der h.M. Z3 als maßgebender Zeitpunkt zugrundegelegt (siehe Rn. 271). Nach dem nunmehr geltenden Tatbestand der Überschuldung (siehe oben V. 3) entscheidet die bilanzielle Vermögenslage nicht mehr allein über das Vorliegen eines Insolvenzeröffnungsgrundes: Bereits im Zeitpunkt Z1 kann Überschuldung gegeben sein, wenn nämlich zugleich eine negative Fortführungsprognosevorliegt. Andererseits kann sogar im Zeitpunkt Z3 die Überschuldung zu verneinen sein, wenn in diesem Zeitpunkt eine positive Fortführungsprognose vorliegt.
294
Um die Folgen dieser Änderung abzumildern, könnte man im Unterschied zur alten Rechtslage im Ausgangspunkt doch auf die Überschuldung nach Handelsbilanzabstellen, mit einigen Modifikationen.[23] Das eigentliche Problem der Unbestimmtheit des Zeitpunkts einer Überschuldung wird damit wegen der Maßgeblichkeit der Fortführungsprognose freilich nicht gelöst. Immerhin aber könnte man so dafür sorgen, dass eine Fortführungsprognose auch tatsächlich aufgestellt wird.[24]
4. Insolvenzanfechtung als (Teil-)Abhilfe des Bewertungsproblems
295
Wenn man noch einmal das oben unter II. dargestellte Beispiel betrachtet, so kann man erkennen, dass die Gesellschafter sich wegen der Fortführungsprämisse der Handelsbilanz unter Umständen noch in einem Zeitpunkt legal Gewinn aus dem Gesellschaftsvermögen nehmen können, in dem die Gesellschaft bereits überschuldet ist. Nach dem Gesagten kann es sein, dass nach geltendem Kapitalerhaltungs- und Bilanzrecht die Gesellschafter sich Bilanzgewinn aus der Gesellschaftskasse nehmen können, ohne gegen § 30 Abs. 1 GmbHG zu verstoßen, obwohl das Gesellschaftsvermögen zu Liquidationswerten bereits nicht mehr zur tatsächlichen Schuldendeckung ausreicht. In einer anschließenden Insolvenz kann sich also herausstellen, dass die Gesellschafter noch kurz vor Stellung des Insolvenzantrages – formaljuristisch korrekt – Bilanzgewinn verteilthaben. Akzeptiert man diese Gewinnentnahme gesellschaftsrechtlich, weil die Kapitalerhaltung eben nur nach handelsbilanziellen Maßstäben durchzuführen ist (s.o. Rn. 176), so bedeutet das noch nicht, dass man eine solche Entnahme auch aus insolvenzrechtlicher Sicht akzeptieren muss. Vielmehr liegt es nahe, in der Insolvenz nicht nur verdeckte Gewinnausschüttungen, sondern sämtliche Gewinnausschüttungenan die Gesellschafter den Regeln über die Insolvenzanfechtung nach den §§ 129 ff. InsO zu unterstellen. Die Insolvenzanfechtung geht der zunächst bestehenden privatrechtlichen Lage vor (sogenannte haftungsrechtliche Unwirksamkeit), so dass die §§ 30 ff. GmbHG die Rechtslage nicht endgültig entscheiden, sondern eben die §§ 129 ff. InsO.[25]
296
Der Insolvenzverwalter kann dann Zuwendungen an die Gesellschafter an die Masse gem. § 143 Abs. 1 S. 1 InsO zurückverlangen, indem er die Rechte aus den §§ 129 ff. InsO geltend macht. Dafür müssen freilich die Tatbestände der §§ 130–135 InsO gegeben sein, die regelmäßig (drohende) Zahlungsunfähigkeitdes Schuldners voraussetzen. Wenn aber, wie § 135 InsO zeigt, die Gesellschafter sich nicht einmal ein kapitalersetzendes Darlehen in der Krise der Gesellschaft zurückzahlen lassen dürfen (ausführlich dazu Rn. 345, 357), dann dürfen sie erst recht keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen an sich veranlassen.
297
Zwar nicht für offene Gewinnausschüttungen (diese sind nicht unentgeltlich), wohl aber für verdeckte Vermögensverlagerungen kommt nach hier vertretener Auffassung ferner die Schenkungsanfechtungnach § 134 InsO in Betracht. Die Kriterien für eine unentgeltliche Leistung (§ 134 InsO) sind nach richtiger Ansicht identisch mit den Maßstäben für eine verdeckte Gewinnausschüttung im Kapitalerhaltungsrecht. Nach dem BGH kommt es für die Unentgeltlichkeit einerseits darauf an, inwieweit die vermögensmindernde Verfügung den Wert einer eventuellen Gegenleistung übersteigt. Andererseits müssen die Parteien dabei den ihnen zustehenden „Bewertungsspielraum“ überschritten haben.[26] Richtigerweise kann das zweite Kriterium (der Bewertungsspielraum) nur eines für die Abgrenzung zwischen einem erlaubten „schlechten“ Geschäft für die insolvente Gesellschaft und einer unentgeltlichen Zuwendung sein. Die Abgrenzung kann also nur objektiv-funktionalerfolgen, da es um den Schutz Dritter (der Gläubiger) geht. Für eine solche objektiv-funktionale Auslegung spricht auch die Regelung des § 134 Abs. 2 InsO, der die Reichweite der Ausnahme von der Schenkungsanfechtung ebenfalls nach objektiven Kriterien bestimmt.[27] Daher kann es bei der Frage des Bewertungsspielraums der Parteien allein darauf ankommen, wieweit die konkreten, objektiv feststellbaren Umstände des Geschäfts die Annahme der Unentgeltlichkeit eines Austauschgeschäfts auszuschließen vermögen. Und damit decken sich die Maßstäbe des § 134 InsO mit der h.M. zur verdeckten Vermögensverlagerung im Gesellschaftsrecht, die dort subjektive Maßstäbe ablehnt.
298
Lösung zu Fall 15:
Wirft die Handelsbilanz wie in Fall 15 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus, so ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet. Nach h.M. löst dieses Ereignis nicht in jedem Fall besondere Pflichten des Geschäftsführers aus, da sich die Frage der Überschuldung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO nicht nach der Handelsbilanz richtet. Diese h.M. ist jedoch abzulehnen, da sie dazu führt, dass der Zeitpunkt der Überschuldung nicht rechtssicher ermittelt werden kann und damit auch nicht überlebensfähige Gesellschaften auf Kosten der Gläubiger weiterwirtschaften können.
Nach hier vertretener Auffassung ist durch eine handelsbilanzielle Überschuldung der Tatbestand des § 19 Abs. 2 InsO erfüllt, so dass der Geschäftsleiter der Kapitalgesellschaft gem. § 15a InsO innerhalb von 3 Wochen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen muss, mindestens aber eine Fortführungsprognose aufstellen und dokumentieren muss, da nur deren tatsächliche Aufstellung und Dokumentation geeignet ist, die überwiegende Wahrscheinlichkeit der Fortführung des Unternehmens im Sinne des § 19 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 InsO zu begründen.
[1]
BGHZ 109, 337: Handelsbilanz ist maßgebend für die Kapitalerhaltung nach § 30 GmbHG.
[2]
Vgl . Baumbach/Hueck/Schulze-Osterloh , 18. Aufl. 2006, § 64 GmbHG Rn. 31.
[3]
Vgl. Baumbach/Hueck/Schulze-Osterloh , 18. Aufl. 2006, § 64 GmbHG Rn. 31.
[4]
Vgl. § 238 Abs. 1 S. 2 HGB: Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens.
[5]
Zu den Gegenargumenten gegen diese zusätzlichen Zwecke siehe Rn. 281 ff.
[6]
Vgl. Staub/Pöschke , § 242 HGB Rn. 7 a.E.
[7]
Vgl. für Bewertung von Rückstellungen § 253 Abs. 1 S. 2 HGB.
Читать дальше