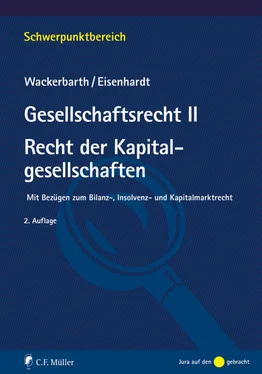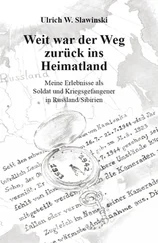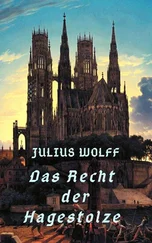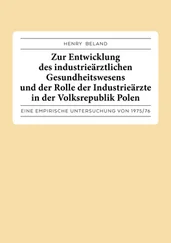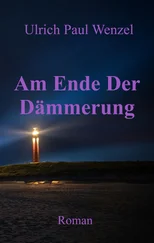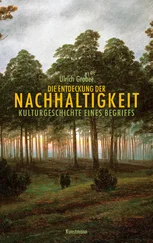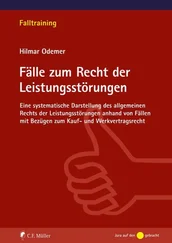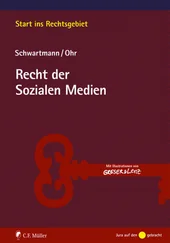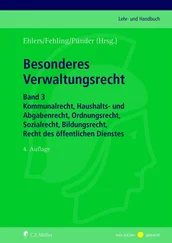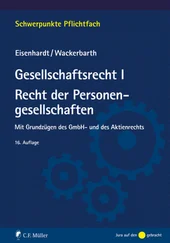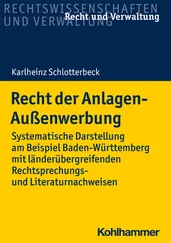270
Das Hauptproblemder Fortführungsprognose ist, dass sie eben nur eine Prognose ist. Der Geschäftsleiter kann natürlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn bloße „Vorhersagen“ später nicht eintreten. Da der Geschäftsleiter um seine Position besorgt ist, wird seine Prognose regelmäßig (zu) gut ausfallen (wenn eine konkrete Prognose mit Finanzplan überhaupt aufgestellt wird, meist ist das nicht der Fall). Daher führt die Fortführungsprognose in der Praxis nur dazu, dass der Insolvenzantrag so lange hinausgeschoben wird, bis die Gesellschaft nicht nur überschuldet ist, sondern auch tatsächlich zahlungsunfähig. Dann aber ist es in aller Regel zu spät für eine Sanierung, das Unternehmen wird zerschlagen, die Gläubiger bleiben auf ihrem Verlust weitgehend sitzen.
2. Feststellung der Überschuldung nach zwischenzeitlichem Insolvenzrecht
271
Die Überschuldung ist bei Kapitalgesellschaften gem. § 19 InsO Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren. Das Gesetz enthielt dafür seit der Einführung der Insolvenzordnung(InsO) im Jahr 1999 bis Oktober 2008 folgende Definition: „Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist jedoch die Fortführung des Unternehmens zugrundezulegen, wenn diese nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist.“
Überschuldung ergab sich demnach allein aus der Aufstellung einer Bilanz, die nicht mit der Handelsbilanz identisch war. Das geschriebene Recht enthielt freilich keinerlei genaue Regeln dafür, wann und wie diese Sonderbilanz genau aufzustellen war. Jedoch war die Bedeutung der Fortführungsprognose durch diese Gesetzesformulierung deutlich begrenzt worden. Entgegen der bis 1999 klaren Auffassung der ganz h.M. ( Rn. 268) entschied die Fortführungsprognose nicht mehr allein über die Überschuldung, sondern nur noch über die Bewertungsprämisseder Überschuldungsbilanz. Jedenfalls dann, wenn eine Bilanzierung unter der Fortführungsprämisse bereits eine Überschuldung ergab, musste auch bei einer positiven Fortbestehensprognose, der Insolvenzantrag gestellt werden.
3. Der Überschuldungsbegriff seit Oktober 2008
272
Mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG), welches im Oktober 2008 in Kraft trat, wurde der Überschuldungsbegriff der InsO erneut geändert. § 19 Abs. 2 InsO lautet nun:
273
„Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.“
274
In der Fachpresse wird diese gesetzliche Neudefinition der Überschuldung als Rückkehr zur Rechtslagevor Inkrafttreten der Insolvenzordnung, nämlich zur Geltung des sog. modifiziert zweistufigen Überschuldungsbegriffs verstanden.[15] Dieses Ziel der Neuformulierung ergibt sich auch aus der Begründung des Entwurfs des FMStG.[16]
b) Inhalt des geltenden Überschuldungstatbestands
aa) Überschuldungsstatus und Fortführungsprognose
275
Nach der Gesetzesformulierung setzt die rechtliche Überschuldung neben der rechnerischen Überschuldung auch eine negative Fortführungsprognose voraus (vgl. § 19 Abs. 2 InsO: „es sei denn...“). Für die rechnerische Überschuldung ist dabei nicht auf die Handelsbilanz der Gesellschaft, sondern auf den Überschuldungsstatusabzustellen (siehe bereits Rn. 267).
276
Die Fortführungsprognose ist eine auf Tatsachengrundlagen erstellte Beurteilung, ob das Unternehmen mittelfristig, d.h. bis zum Ende des laufenden und des folgenden Geschäftsjahres, die fälligen Verpflichtungen wird erfüllen können. Die Fortführungsprognose ist also eine sog. Zahlungsfähigkeitsprognose. In der Regel setzt eine positive Prognose den Fortführungswillen des Schuldners sowie ein tragfähiges Unternehmenskonzeptund einen dokumentierten Finanz- und Ertragsplanvoraus.[17] Wird die mittelfristige Überlebensfähigkeit des Unternehmens mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 % prognostiziert, tritt trotz rechnerischer Unterdeckung also keine rechtliche Überschuldung ein. Ein Insolvenzantrag braucht dann nicht gestellt zu werden.
277
Beide Elemente der Überschuldung (Zahlenwerk und Prognose) stehen gleichrangig nebeneinander. Nur wenn rechnerische Überschuldung und negative Prognose gegeben sind, liegt auch Überschuldung im Rechtssinne vor. Die Reihenfolge der Prüfungist dementsprechend gleichgültig. Die Geschäftsleitung kann entscheiden, welche der beiden Prüfungen sie für weniger aufwändig hält und dementsprechend zuerst anstellt.
bb) Zeitpunkt der Überschuldungsprüfung
278
Die aus der früheren Rechtslage bekannten Rahmenbedingungenfür die Prüfung sind denkbar unbestimmtgeblieben, insbesondere was den Zeitpunkt angeht. Auch ihr Hauptvertreter, K. Schmidt , gibt nicht an, wann genau die Prüfung anzustellen ist.[18] Er meint, ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter mache einen Insolvenzstatus selbstverständlich erst auf, wenn die Unternehmensprognose zu Zweifeln Anlass gibt. Diese soll „in der Nähe der Krise auch durch Finanzpläne belegt sein“. Damit wird nicht klar, was und wann der Geschäftsleiter nun genau tun soll. Soll er ständig Prognosen anstellen, die irgendwann zu Zweifeln Anlass geben und (erst) dann die Aufstellung einer echten Fortbestehensprognose gebieten? Oder geht es lediglich um eine nicht näher bestimmte Selbstprüfungsobliegenheit des Geschäftsleiters?
279
Auch sonst wird der Zeitpunktfür eine Überschuldungsprüfung zwar etwas näher, aber gleichwohl im Ergebnis nicht ausreichend und vor allem in ganz unterschiedlicher Weise bestimmt: So soll etwa der Zeitpunkt gekommen sein, wenn es Zeichen für eine Krise gibt oder wenn sich ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten abzeichnen (wann ist das genau der Fall?), insbesondere, wenn die Hälfte des Stammkapitals verbraucht ist oder Überschuldung nach Handelsbilanzvorliegt.[19] Nach Wimmer sollen „alle Alarmglocken der Gesellschaft klingeln“, wenn rechnerische Überschuldung vorliegt. Aber eine rechnerische Überschuldung setzt ja die Aufstellung einer Sonderbilanz (Überschuldungsstatus) voraus ( Rn. 267)! Und wann diese Sonderbilanz aufgestellt wird, beantwortet Wimmer nicht.[20]
cc) Maßstäbe für die Aufstellung der Fortführungsprognose und Beweislast
280
Was die Maßstäbe für die Prognose angeht, so kann nach K. Schmidt eine positive Fortbestehensprognose nur auf die Wirtschaftskraft der Gesellschaft selbst, ggf. auch auf ein realisierbares Sanierungskonzeptgestützt werden, nicht auf die bloße Erwartung von Sanierungshilfen seitens Dritter.[21] Ferner wird auf die Erstellung einer Ertrags- und Finanzplanung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen verwiesen und deren Aussagekraft sowie Realitätsnähe betont. Für die Tatsachengrundlagen einer positiven Fortführungsprognose trägt nach mittlerweile h.M. die Geschäftsleitung die Darlegungs-und auch die Beweislast.[22]
Читать дальше