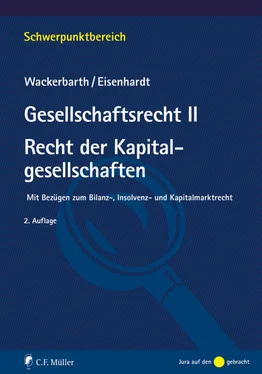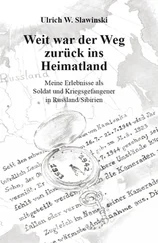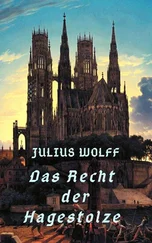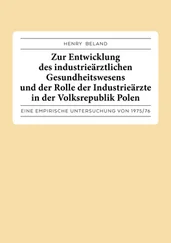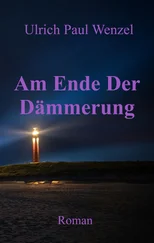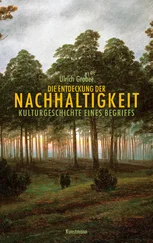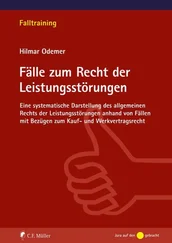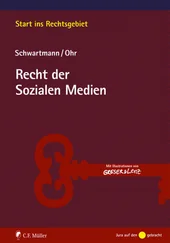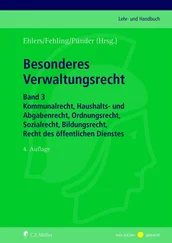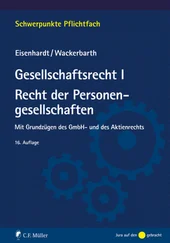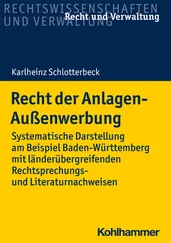1.Rückzahlungsverbot, Verbot der Einlagenrückgewähr
a) Beginn des Verbots von Zahlungen an die Gesellschafter
b) Begriff der Zahlung: Vermögensverlagerungen zum Gesellschafter
c) In der Aktiengesellschaft: Bindung des gesamten Vermögens gegenüber verdeckten Gewinnausschüttungen
d) Rechtsfolge bei Verstoß
2.Insolvenzantragspflicht der Geschäftsleiter bei Überschuldung
a) Antragspflicht
b) Rechtsfolgen bei Verstoß
c) Bedeutung für den Gläubigerschutz
3.Die Grundidee des Gläubigerschutzsystems
a) Finanzielle Betrachtung
b) Prognoseabhängigkeit nach der Rechtsprechung
c) Psychologische Wirkungen der Regeln der Kapitalerhaltung
VI. Details zur Kapitalerhaltung
1. Analoge Anwendung des § 30 GmbHG auf Umgehungsfälle
2. §§ 89 Abs. 3, 115 Abs. 2 AktG analog
3. Darlehensgewährung an Gesellschafter und Aktiventausch
4. Mithaftung anderer Gesellschafter nach § 31 Abs. 3 GmbHG
5.Haftung des Geschäftsführers
a) Schadensersatzpflicht nach § 43 Abs. 3 GmbHG
b) Haftung nach § 31 Abs. 6 GmbHG
6. Haftung nach Verkauf der Geschäftsanteile
7. Erwerb eigener Anteile
§ 6 Bilanz- und Insolvenzrecht
I. Übersicht
II. Nochmals: Die Vermögensentwicklung einer Kapitalgesellschaft
III. Die Abhängigkeit des Kurvenverlaufs von den Prämissen der Bilanzierung
IV.Welches sind die Zwecke der Handelsbilanz
1.Ausgangspunkt
a) Überblick über die Lage und weitere Zwecke
b) Dokumentationsfunktion
c) Pflicht zur Selbstinformation?
2. Aussagekraft der Handelsbilanz?
3. Maßgeblichkeit der Gläubigerperspektive!
V.Materielle Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
1.Allgemeine Grundsätze
a) Fortführungsprinzip (going concern)
b) Vorsichtsprinzip
c) Realisationsprinzip
d) Imparitätsprinzip
2.Spezielle Bewertungsgrundsätze
a) Stichtagsprinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB
b) Einzelbewertung, § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB
c) Anschaffungswertprinzip, § 253 Abs. 1 S. 1 HGB
d) Planmäßigkeit der Abschreibung, § 253 Abs. 3 S. 1, 2 HGB
3. Aktivierungs-/Passivierungswahlrechte/Bewertungswahlrechte
4. Folgen
5. Ein einheitliches Prinzip?
VI.Wie wird die Überschuldung tatsächlich festgestellt?
1. Der modifiziert zweistufige Überschuldungsbegriff nach altem Recht
2. Feststellung der Überschuldung nach zwischenzeitlichem Insolvenzrecht
3.Der Überschuldungsbegriff seit Oktober 2008
a) Einführung
b) Inhalt des geltenden Überschuldungstatbestands
VII.Der hier vertretene Standpunkt
1. Fortführungsprinzip und Vorsichtsprinzip als Gefahren für die Gläubiger
2.Wann sollte ein Insolvenzantrag gestellt werden?
a) Überschuldung nach Überschuldungsbilanz
b) Überschuldung nach Fortführungswerten
c) Überschuldung nach Liquidationswerten
d) Widerlegung des Hauptgegenarguments
3. Konsequenzen für die Auslegung des seit Oktober 2008 geltenden § 19 Abs. 2 InsO
4. Insolvenzanfechtung als (Teil-)Abhilfe des Bewertungsproblems
§ 7 Durchgriffshaftung der Gesellschafter, Gesellschafterdarlehen
I. Zivilrecht (Haftung des Gesellschafters und der Geschäftsführung)
II.Durchgriffshaftung der Gesellschafter
1. Notwendigkeit eines Durchgriffs auf die Gesellschafter
2. Rechtstechnische Begründung
3.Mögliche Fallgruppen
a) Vermögensvermischung
b) Haftung der Gesellschafter wegen materieller Unterkapitalisierung?
c) Haftung wegen intensiver Beherrschung der Kapitalgesellschaft durch ihren Allein- oder Mehrheitsgesellschafter? (Gleichlauf von Herrschaft und Haftung)
d) Instrumentalisierung der Haftungsbeschränkung
4. Existenzvernichtungshaftung
5.Fazit: Durchgriffshaftung nach § 826 BGB bei Systemmissbrauch
a) Beschränkter „Durchgriff“ auf die Gesellschafter und Dritte bei einzelnen Verstößen gegen das System
b) § 826 BGB als generalklauselartiger Schutz des Systems
c) Die Haftung nach § 826 BGB als Innenhaftung im Rahmen des Insolvenzverfahrens
d) Ausnahmecharakter und Rechtswirklichkeit
III.Das Recht der Gesellschafterdarlehen zwischen Gesellschafts- und Insolvenzrecht
1. Historische Entwicklung
2.Grundgedanke des Kapitalersatzrechts
a) GmbH
b) Übertragung auf die Aktiengesellschaft
3. Tatbestand des Kapitalersatzes im Einzelnen
a) Zuwendung auf Zeit (Finanzierungshilfe)
b) Durch einen Gesellschafter (oder einen gleichgestellten Dritten)
c) In der Krise der Gesellschaft
4.Rechtsfolgen
a) Gesetzliche Rechtsfolgen
b) Zusätzliche Folgen nach der Rechtsprechung
5.Das neue Recht der Gesellschafterdarlehen
a) Modernisierung des Kapitalersatzrechts durch das MoMiG
b) Insolvenzrecht, §§ 39, 135 InsO
c) Details
Teil 4 Rechte und Pflichten der Gesellschafter
§ 8 Überblick über die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten
I.Mitgliedschaftsrechte und -pflichten bei der AG
1. Übersicht
2. Insbesondere das Auskunftsrecht nach § 131 AktG
3. Klagerechte
II.Mitgliedschaft in der GmbH
1. Der Geschäftsanteil
2. Die einzelnen Mitgliedschaftsrechte und -pflichten
3. Klagerechte
III.Die mitgliedschaftliche Treuepflicht jedes Gesellschafters
1.Allgemeines
a) Unterscheidung von der organschaftlichen Treuepflicht
b) Rechtsgrundlage
c) Intensität unterschiedlich
2.Fallbeispiele für die Anwendung der Treuepflicht
a) In-Sich-Geschäfte des Mehrheitsgesellschafters (ITT)
b) Treuwidriger Auflösungsbeschluss (Linotype)
c) Treue der Minderheitsgesellschafter (Girmes-Fall)
3.Grundfragen der Treuepflicht
a) Wer schuldet wem Treue?
b) Unabdingbarkeit der Treuepflicht
c) Konkrete Folgen der Treuepflicht
§ 9 Gesellschaftsinterne Willensbildung durch Beschlussfassung auf der Gesellschafterversammlung
I. Einführung
II. Unterschiedliche Reichweite der Gesellschafterzuständigkeit in der AG und in der GmbH
III.Durchführung der Gesellschafterversammlung
1.Formale Vorbereitung
a) Die Bedeutung der formalen Verfahrensvorschriften
b) Ordnungsgemäße Einberufung
c) Zulässiger Ort
d) Tagesordnung
2.Ordnungsgemäßer Ablauf der Gesellschafterversammlung
a) Bestimmung eines Versammlungsleiters
b) Aufgaben und Befugnisse
c) Protokollierung der Versammlung, § 130 AktG
IV.Beschlussfassung
1. Beschluss, Wirksamkeit, Ausführung
2. Erforderliche Mehrheiten
3. Fehlerfreier Beschluss
V.Stimmrecht
1. Stimmrecht, Stimmabgabe, Stimmpflicht
2.Stimmverbote
a) Allgemeines und Wirkungsweise
b) Das Verbot des „Richtens in eigener Sache“
c) Das Verbot des Abstimmens über Rechtsgeschäfte mit sich selbst
3.Abdingbarkeit der Stimmverbote?
a) Die im Schrifttum herrschende Auffassung
b) Keine Abbedingung, allenfalls Konkretisierung möglich
c) Treuepflicht allein genügt nicht
VI.Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Beschlüssen, Anfechtungsklage
1.Anfechtungsklage
a) Rechtspolitische Problematik
b) Allgemeine Voraussetzungen der Anfechtungsklage
c) Anfechtungsgründe
d) Relevanz für das Beschlussergebnis bei Verfahrensverstößen
e) Bestätigung anfechtbarer Beschlüsse, § 244 AktG
f) Wirkung des Urteils, § 248 AktG
2. Nichtigkeitsklage, § 241 AktG
3. Positive Beschlussfeststellungsklage
4. Rechtslage bei der GmbH
§ 10 Minderheitenschutz
I. Die Leitungsmacht des Mehrheitsgesellschafters
II.Machtkontrolle durch Klagemöglichkeiten
1.Anfechtungsklage und Alternativen
a) Die Anfechtungsklage als ungeeignetes Instrument
Читать дальше