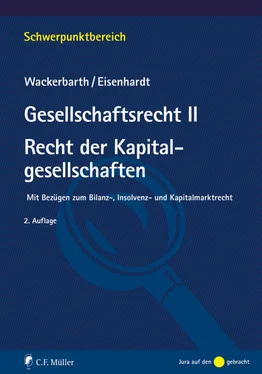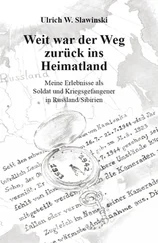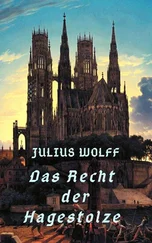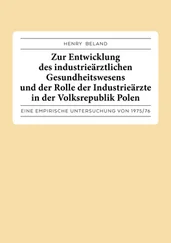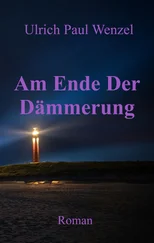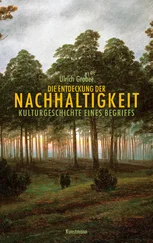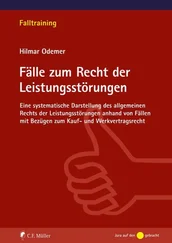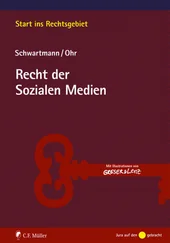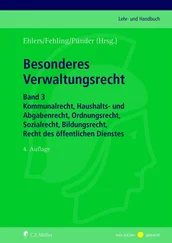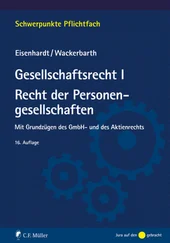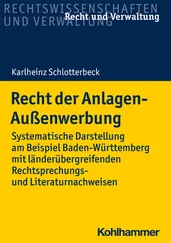Teil 1 Einleitung
§ 1 § 1 Unternehmens- und Gesellschaftsrecht im System des Rechts Inhaltsverzeichnis I. Unternehmen und Macht II. Was ist Unternehmensrecht? III. Einführung in die Problematik der verdeckten Vermögensverlagerungen 1 Fall 1: A (50 %), B und C (je 25 %) sind Gesellschafter der X-GmbH. A ist zum alleinigen Geschäftsführer bestellt worden, dafür erhält er ein jährliches Gehalt von 100.000 €. Wegen außerordentlicher Leistungen des A erwirtschaftet die X-GmbH im Jahr 2010 einen um 100 % höheren Gewinn als in den Vorjahren (300.000 € statt 150.000 €). Daraufhin vereinbart A mit seinem Freund F, dass dieser der GmbH, vertreten durch A, einen neuen Dienstwagen (Marktpreis 20.000 €) für 30.000 € verkauft und dem A persönlich 10.000 € in bar aushändigt. Als B und C von dem Geschäft erfahren sind sie empört. Sie verlangen von A Zahlung von 10.000 € an die Gesellschaft. A macht geltend, seine Anstrengungen im Jahr 2010 rechtfertigten durchaus einen Sonderbonus in dieser Höhe für ihn. Er dürfe das Geld daher behalten. Stimmt das? Rn. 27 Literatur: Röhricht , Von Rechtswissenschaft und Rechtsprechung, ZGR 1999, 445 ff. Teil 1 Einleitung › § 1 Unternehmens- und Gesellschaftsrecht im System des Rechts › I. Unternehmen und Macht
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht im System des Rechts § 1 Unternehmens- und Gesellschaftsrecht im System des Rechts Inhaltsverzeichnis I. Unternehmen und Macht II. Was ist Unternehmensrecht? III. Einführung in die Problematik der verdeckten Vermögensverlagerungen 1 Fall 1: A (50 %), B und C (je 25 %) sind Gesellschafter der X-GmbH. A ist zum alleinigen Geschäftsführer bestellt worden, dafür erhält er ein jährliches Gehalt von 100.000 €. Wegen außerordentlicher Leistungen des A erwirtschaftet die X-GmbH im Jahr 2010 einen um 100 % höheren Gewinn als in den Vorjahren (300.000 € statt 150.000 €). Daraufhin vereinbart A mit seinem Freund F, dass dieser der GmbH, vertreten durch A, einen neuen Dienstwagen (Marktpreis 20.000 €) für 30.000 € verkauft und dem A persönlich 10.000 € in bar aushändigt. Als B und C von dem Geschäft erfahren sind sie empört. Sie verlangen von A Zahlung von 10.000 € an die Gesellschaft. A macht geltend, seine Anstrengungen im Jahr 2010 rechtfertigten durchaus einen Sonderbonus in dieser Höhe für ihn. Er dürfe das Geld daher behalten. Stimmt das? Rn. 27 Literatur: Röhricht , Von Rechtswissenschaft und Rechtsprechung, ZGR 1999, 445 ff. Teil 1 Einleitung › § 1 Unternehmens- und Gesellschaftsrecht im System des Rechts › I. Unternehmen und Macht
I.Unternehmen und Macht
1.Komplexität und Macht
a) Die Vielzahl von Gesetzen und anderen Regeln
b) Warum so kompliziert?
c) Komplexität schafft Machtspielräume
d) Ebenso das juristische Spezialistentum
2. Die Rolle der Wissenschaft
3. Schlussfolgerungen
II. Was ist Unternehmensrecht?
III.Einführung in die Problematik der verdeckten Vermögensverlagerungen
1. Verdeckte Vermögensverlagerung als zentrales Problem
2.Mögliche rechtliche Konsequenzen
a) Verbot von Austauschgeschäften?
b) Veto-Recht der anderen Gesellschafter
c) Alternativen?
3. Verdeckte Vermögensverlagerungen und Gläubigerschutz
Teil 2 Die Organisation der Kapitalgesellschaft
§ 2 Übersicht über das Recht der Kapitalgesellschaften und Rechtstatsachen
I.Typen der Unternehmensträger
1. Typenvielfalt im Gesellschaftsrecht
2. Einzelkaufmann <=> Gesellschaft
3. Unternehmensträger mit Haftungsbeschränkung <=> ohne Haftungsbeschränkung
4. Die Reihenfolge der Darstellung
II.Warum die Unterscheidung zwischen AG und GmbH?
1. Kein Unterschied im Wesen
2. Gesetzliche Hauptunterschiede zwischen AG und GmbH
3. Andere Rechtsordnungen
III.Hauptfragen des Kapitalgesellschaftsrechts
1. Hauptmerkmale der Kapitalgesellschaften
2. Hauptprobleme
a) Schutz der Gläubiger
b) Schutz der Öffentlichkeit vor der Anthropomorphisierung der Juristischen Person
c) Schutz der Minderheit vor der Mehrheit
§ 3 AktG und GmbHG
I. Zweck der folgenden Darstellung
II.Die Orientierung der beiden Gesetze am „Lebenszyklus“
1. Der Lebenszyklus einer unternehmenstragenden Kapitalgesellschaft
2. Übersicht über AktG und GmbHG
III. Die wichtigsten beteiligten Personen (Organe)
§ 4 Pflichten, Haftung und Überwachung der Geschäftsführung
I.Treuepflicht zur Gesellschaft
1. Organschaftliche Treuepflicht
2.Gesetzliche Ausprägungen der Treuepflicht
a) Wettbewerbsverbot
b) Geschäftschancenlehre
c) Geheimhaltungspflichten
II.Sorgfaltspflichten der Geschäftsleitung
1.Pflicht zur sorgfältigen Führung des Unternehmens
a) Einzelpflichten im Gesetz
b) Allgemeine Sorgfaltspflicht
c) Pflicht zur Legalität?
d) Compliance und interne Ermittlungen?
2.Pflichten im Gläubigerinteresse (nicht durch Gesellschafterbeschluss verzichtbar)
a) Überwachung der Kapitalerhaltung
b) Insolvenzantragspflicht
c) Insoweit: keine Folgepflicht
3.Der unternehmerische Handlungsspielraum
a) Die Business Judgment Rule im amerikanischen Recht
b) Deutsches Recht
c) Die Regelung der BJR in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG
III.Haftung der Organmitglieder
1.Haftung der Mitglieder der Geschäftsleitung nach außen und innen
a) Anspruchsgrundlagen der Gläubiger gegen die Geschäftsleitungsmitglieder im Außenverhältnis
b) Anspruchsgrundlagen im Innenverhältnis
c) Haftung von Strohmännern und faktischen Geschäftsleitern
2.Ausschluss der Haftung durch Entscheidung der Gesellschafter
a) Aktiengesellschaft
b) GmbH
c) Ergebnis
IV.Überwachung der Geschäftsführung
1. Überwachung durch die übrigen Organe
2.Bedeutende Geschäfte der Gesellschaft mit den Geschäftsleitern
a) Einschränkung der Kreditvergabe an Organmitglieder
b) Die Problematik überhöhter Vorstandsgehälter im Aktienrecht
c) Die Problematik verdeckter Gewinnausschüttungen durch Geschäftsführergehälter in der GmbH
3.Durchsetzung der Haftung
a) Allgemeines
b) Durchsetzung der Haftung in der GmbH
c) Durchsetzung der Haftung in der AG
Teil 3 Gläubigerschutz
§ 5 Grundfragen und Prinzip der Kapitalerhaltung
I.Pflichten und Haftung der Kapitalgesellschaft im Wege der Zurechnung
1. Vertragliche Verbindlichkeiten
2.Zurechnung pflichtwidrigen Verhaltens
a) Zurechnung erforderlich
b) Zurechnung von Verschulden im Rahmen vertraglicher Sonderverbindungen gem. § 278 BGB oder § 31 BGB?
c) Zurechnung deliktischer Verantwortlichkeit
II.Die Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen
1. Was bedeutet „beschränkte“ Haftung?
2. Haftungsbeschränkung und besondere Haftungstatbestände für Gesellschafter und/oder Geschäftsleiter
3. Die ökonomische Beurteilung des Instituts der Haftungsbeschränkung
III.Grundfragen des Gläubigerschutzes
1. Gläubigerschutz warum?
2. Gläubigerschutz wann?
3. Gläubigerschutz vor wem?
4. Gläubigerschutz wie?
5. Überblick über Rechtsinstitute des Gläubigerschutzes
IV. Die Vermögensentwicklung einer Kapitalgesellschaft
1. Drei Phasen im „Lebenslauf“ einer Kapitalgesellschaft
2.Die drei Phasen anhand des Beispiels aus der Grafik
a) Erläuterung
b) Bilanzielle Betrachtungsweise
3.Bedeutung und Zweck des gesetzlichen Mindestkapitalerfordernisses
a) Mindestkapital und Satzungskapital
b) Fehldeutungen
c) Die wahre Funktion des Mindestkapitalerfordernisses
4. Einführung der UG (haftungsbeschränkt)
V. Das Prinzip der Kapitalerhaltung und wie es die Gläubiger schützen soll
Читать дальше