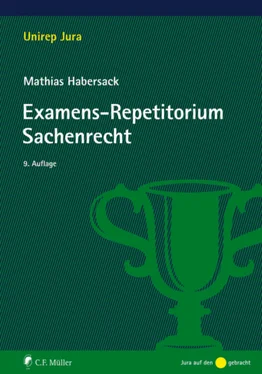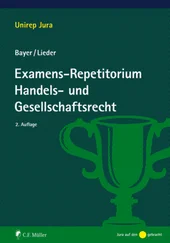2. Übertragung und Belastung von Rechten im Besonderen
21
Der Kreis der Verfügungsgeschäfte geht deutlich über die Übertragung eines Rechts hinaus.
→ Definition:
Verfügungist vielmehr jedes Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf ein bestehendes oder als bestehend gedachtes[1] Recht einwirkt, neben der Übertragung also die Belastung, die Aufhebung und die Inhaltsänderung eines Rechts.
Für andere als auf Rechtsübertragung gerichtete Verfügungsgeschäfte hat das BGB auf allgemeine Vorschriften nach Art der §§ 398 ff., 413 ( Rn. 19 f.) verzichtet. Es regelt vielmehr Voraussetzungen und Rechtsfolgen solcher Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit dem jeweiligen Verfügungsgeschäft und unterscheidet zudem zwischen den verschiedenen Verfügungsgegenständen.
22
Auch die Vorschriften über die Belastung von Rechtenlassen freilich das Bestreben des Gesetzgebers nach Schaffung allgemeiner Regeln, von denen es sodann Ausnahmebestimmungen für besondere Belastungsgegenstände gibt, deutlich erkennen. So finden die §§ 1204 ff. über das Pfandrecht an beweglichen Sachen nach § 1273 Abs. 2 S. 1 auch auf das „Pfandrecht an Rechten“ ( Rn. 10 f.) entsprechende Anwendung, soweit nicht die §§ 1274 ff. besondere Vorschriften enthalten. Die Vorschriften der §§ 1274 ff. verstehen sich ihrerseits als allgemeine Vorschriften. Für das „Pfandrecht an einer Forderung“ gelten nämlich die Sondervorschriften der §§ 1280 ff., die, soweit sie lückenhaft sind, durch die allgemeinen Vorschriften der §§ 1273 ff., 1204 ff. ergänzt werden. Ganz ähnlich ist die Systematik der §§ 1030 ff. betreffend den Nießbrauch. Die Regelungstechnik des Gesetzgebers bringt es allerdings mit sich, dass die Vollübertragung der Forderung im Allgemeinen Schuldrecht, die Belastung der Forderungdagegen im Sachenrechtgeregelt ist. Schon dies zeigt, dass es sich unter systematischen Gesichtspunkten angeboten hätte, in den Allgemeinen Teil des BGB einen Abschnitt über Verfügungsgeschäfte aufzunehmen.
II. Charakteristika des dinglichen Rechtsgeschäfts
1. Mehraktiger Verfügungstatbestand
23
Der Gesetzgeber des BGB war darauf bedacht, Verfügungen über Rechte an Sachen dem Publizitätsgrundsatz zu unterstellen: Die Erfüllung eines Publizitätstatbestands gehört grundsätzlich zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen des Verfügungsgeschäfts. So bedarf nach §§ 873 Abs. 1, 875 ff. jede Verfügung über ein Recht an einem Grundstück der Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch. Die Übereignung oder Belastung einer beweglichen Sache setzt nach §§ 929 S. 1, 1032 S. 1, 1205 Abs. 1 S. 1 grundsätzlich deren Übergabe voraus. Aneignung und Dereliktion schließlich sind nach §§ 958 f. an die Erlangung bzw. Aufgabe des Besitzes gebunden.
24
Die Entscheidung für einen mehraktigen Verfügungstatbestand wirft eine Reihe von Folgefragenauf. Klar ist zunächst, dass nur das rechtsgeschäftliche Element und die Verwirklichung des Publizitätstatbestands zusammen die Rechtsänderung herbeizuführen vermögen, wobei allerdings die Reihenfolge unerheblich ist. Vorbehaltlich des § 878 ( Rn. 297 f.) muss zudem die Verfügungsbefugnis des Veräußerersnoch im Zeitpunkt der Vollendung des gesamten Verfügungstatbestands bestehen. Kommt es nach Abgabe der Einigungserklärung zum Eintritt des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit einer Partei, so finden §§ 130 Abs. 2, 153 Anwendung. Was die Frage der Bindung an die Einigungbetrifft, so stellt § 873 Abs. 2 für Verfügungen über Rechte an Grundstücken klar, dass beide Parteien an die Einigung gebunden sind, wenn die Erklärungen in bestimmter Form verlautbart wurden. Fehlt es an den Voraussetzungen des § 873 Abs. 2, so kann jede Partei ihre Einigungserklärung widerrufen, solange nicht der Publizitätstatbestand verwirklicht und damit der Verfügungstatbestand komplettiert ist. Der Widerruf mag dann zwar dem Verpflichtungsgeschäft zuwiderlaufen ( Rn. 27 ff.); die dingliche Einigung ist jedoch auch dann entfallen, wenn nach der Erklärung des Widerrufs der Publizitätstatbestand verwirklicht wird. Ist umgekehrt die Einigung bindend, so kann der Veräußerer, solange er noch Eigentümer ist, sein Grundstück gleichwohl anderweit veräußern oder belasten[2].
25
Hinsichtlich der Frage der Bindung des Veräußerers einer beweglichenSache bleibt das Gesetz eine eindeutige Antwort schuldig. Die hM geht jedoch zu Recht davon aus, dass eine Bindung angesichts der Wertung des § 873 Abs. 2 und des Wortlauts des § 929 S. 1, der ein Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe verlangt („einig sind“), nicht in Betracht kommt[3]. Der Veräußerer kann mithin seine Einigungserklärung noch bis zur Übergabe der Sache widerrufen. Dem kommt vor allem im Zusammenhang mit dem „nachträglichen“ Eigentumsvorbehalt Bedeutung zu: Haben sich Verkäufer und Käufer zunächst unbedingt über den Übergang des Eigentums geeinigt, so kann der Veräußerer gleichwohl bis zur Übergabe seine Erklärung widerrufen[4] und die aufschiebend bedingte Übereignung anbieten. Nimmt der Käufer diesen Antrag an, so hat er nur aufschiebend bedingt Eigentum erworben ( Rn. 239).
26
Solange der mehraktige Erwerbstatbestand nicht vollendet ist, hat der Veräußerer sein Recht nicht verloren und der Erwerber das Vollrecht nicht erworben. Unter Umständen ist aber der Erwerberbereits Inhaber eines Anwartschaftsrechts( Rn. 54 ff.). So verhält es sich insbesondere in dem Fall, dass zwar die Auflassung des Grundstücks erfolgt ist, die Eintragung in das Grundbuch aber noch aussteht ( Rn. 299 ff.), ferner in dem Fall, dass die Hypothek zwar bestellt, die gesicherte Forderung aber noch nicht entstanden ist ( Rn. 372). Aber auch das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers beruht darauf, dass der mehraktige Erwerbstatbestand noch nicht voll verwirklicht ist: Zwar ist die Übergabe bereits erfolgt, die Wirkungen der Einigung sind aber durch Aufnahme einer Bedingung hinausgeschoben ( Rn. 230 ff.).
2. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft
27
Das BGB unterscheidet, wie schon die Existenz seiner §§ 398, 873, 929 belegt, zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften[5]. Während das Verpflichtungsgeschäft anspruchs- und pflichtenbegründend und zudem nur inter parteswirkt, wird durch das Verfügungsgeschäft auf ein bestehendes oder als bestehend gedachtes Recht unmittelbar eingewirkt. Die Eigenständigkeit des Verfügungsgeschäfts bringt es mit sich, dass die Wirksamkeit der Verfügung von der Berechtigung des Verfügendenabhängt. Sofern nicht die fehlende Berechtigung durch die Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb überspielt wird oder der Verfügende durch den Berechtigten zur Verfügung ermächtigt worden ist ( Rn. 140 ff., 147 ff.), bewendet es also bei dem Grundsatz „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“.
28
Die Trennung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft ist keineswegs so lebensfremd, wie es auf den ersten, durch das Bild vom Zeitungs- oder Brötchenkauf geprägten Blick erscheinen mag[6]. So begegnet es außerhalb der Geschäfte des täglichen Lebens durchaus häufig, dass die Erfüllung hinausgeschoben wird, etwa weil sich der Schuldner die zu liefernde Sache erst noch beschaffen muss. Zudem ermöglicht es das Trennungsprinzip, einerseits einen unbedingten Kaufvertrag zu schließen, andererseits die Wirkungen der dinglichen Einigung hinauszuschieben, indem der Eigentumsübergang unter die Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung gestellt wird ( Rn. 230 ff.).
Читать дальше