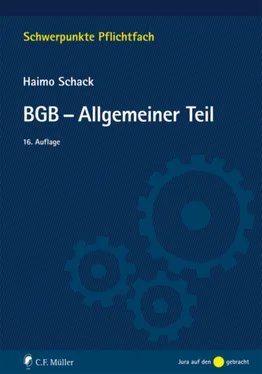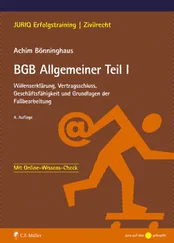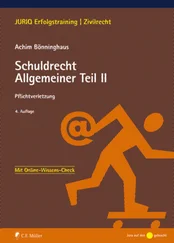Im Fall 8sind danach die Maschinen, die speziell für das Gebäude konstruiert worden sind oder für die das Gebäude errichtet worden ist, wesentliche Bestandteile des Gebäudes und damit des Grundstückes.
F164
§ 94 I schützt die Wirtschaftseinheit „Grundstück“, § 94 II die des Gebäudes. Die beiden Zielsetzungen kollidieren im Fall des Überbaus, § 912, wenn ein Teil des Gebäudes über die Grenze gebaut worden ist. Muss der Eigentümer des Nachbargrundstücks den Überbau nicht dulden, dann lässt BGH NJW 1985, 789, 790 f die wirtschaftliche Einheit des Gebäudes zurücktreten (Vertikalteilung): Der Überbau ist nicht nach §§ 93, 94 II wesentlicher Bestandteil des Gebäudes, sondern nach § 94 I des (Nachbar)Grundstücks.
165
3. Die Ausnahmevorschrift des § 95 für sog. Scheinbestandteileist auf Grundstücke beschränkt. § 95 verhindert schlechthin, dass die dort genannten Sachen zu Bestandteilen werden. Vorübergehendist die Sache eingefügt, wenn der Einfügende die Verbindung vor Ende der natürlichen Lebensdauer der Sache wieder lösen will. § 95 I 1 wird vor allem bei Miet- und Pachtverhältnissen praktisch. Hingegen meint § 95 I 2 mit dem Recht, in dessen Ausübung der Gegenstand eingefügt ist, ein dingliches Recht an dem Grundstück, also zB Erbbaurecht, Nießbrauch.
Scheinbestandteile sind zB Baubuden, die Treibhäuser eines Pächters, die Pflanzen in einer Baumschule, unter Umständen auch Windkraftanlagen (BGH NJW 2017, 2099) und sogar ein Westwall-Bunker, weil er nur zu einem vorübergehenden Zweck errichtet worden sei (BGH NJW 1956, 1273). Scheinbestandteil des Grundstücks analog § 95 I 2 ist auch der zu duldende Überbau (BGHZ 41, 177, 179). Vgl Stieper , Die Scheinbestandteile 2002.
Die unter § 95 fallenden Sachen sind überhaupt keine Bestandteile, sondern völlig selbstständige bewegliche Sachen. Für die Übereignung von Scheinbestandteilen gelten die Vorschriften über bewegliche Sachen der §§ 929 ff, und nicht etwa § 873. Auch die Hypothek erstreckt sich nicht auf sie. Zur problematischen Umwandlung von wesentlichen in Scheinbestandteile durch deren Übereignung analog § 929 Satz 2 vgl BGHZ 165, 184 ff (Versorgungsleitung in einem Straßengrundstück).
166
Was die Rechtsfigur des Bestandteils „als Klammer um eine Wirtschaftseinheit“ leisten kann, macht Fall 8deutlich: Das Fabrikgrundstück ist mit den Gebäuden und den fest eingebauten Maschinen (also nicht die Lastwagen, Bagger usw), mit den Bäumen und den Sträuchern also mit allen seinen wesentlichen Bestandteilen, eine rechtliche Einheit. Einschließlich seiner einfachen Bestandteile kann das Grundstück als Einheit veräußert werden. Darüber hinaus leistet die Rechtsfigur des Bestandteils jedoch nichts, um die wirtschaftliche Unternehmenseinheit rechtlich anzuerkennen.
167
4. Das zum Unternehmen gehörende Steinbruchgrundstück des U ist eine selbstständige Sache, also kein Bestandteil. Es kann als unbewegliche Sache auch kein Zubehör des Fabrikgrundstücks sein (vgl unten Rn 169). Die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit der beiden Grundstücke findet also keinen rechtlichen Ausdruck.
Sind alle zum Fabrikgrundstück gehörenden Flächen unter einer Nummer im Grundbuch eingetragen, dann bilden sie ein Grundstück, andernfalls so viele Grundstücke, wie Nummern im Bestandsverzeichnis des Grundbuchblatts eingetragen sind. Immerhin kann U seine beiden Grundstücke vereinigen, indem er sie unter einer laufenden Nummer im Grundbuch eintragen lässt, § 890 I (dazu § 5 GBO), oder er könnte den Steinbruch durch Zuschreibung, § 890 II, zum Bestandteil des Fabrikgrundstücks machen. Doch bedeutet das keine starke Klammer, weil die Einheit jederzeit wieder gelöst werden kann (Abschreibung). Zum Grundstücksbegriff vgl H.P. Westermann/Staudinger , Schwerpunkte BGB SachenR 132017, Rn 347 ff.
F168
5. Auf besondere Weise ist die Grunddienstbarkeit am Grundstück des E mit dem Fabrikgrundstück verbunden. Sie ist ein sog. subjektiv-dingliches Recht, § 1018, das § 96 zum Bestandteil des herrschenden Grundstücks erklärt.
Die Grunddienstbarkeit als beschränktes dingliches Recht belastet das Grundstück des E. Ihre Verbindung mit dem Fabrikgrundstück des U bedeutet, dass der jeweilige Eigentümer des Fabrikgrundstücks auch der Berechtigte der Grunddienstbarkeit ist. Das Eigentum am Fabrikgrundstück bestimmt den Inhaber der Grunddienstbarkeit, also das Rechtssubjekt. Daher erklärt sich der Ausdruck „subjektiv-dinglich“: Ein dinglicher Tatbestand, nämlich das Eigentum am Fabrikgrundstück, bestimmt das Rechtssubjekt der Grunddienstbarkeit. (Die Unterscheidung subjektiv-dinglicher von subjektiv-persönlichen Rechten wird besonders deutlich bei der Reallast in §§ 1105 und 1110 f und beim Vorkaufsrecht in § 1094.)
Die von § 96 angeordnete Verbindung von Recht und Grundstück bringt zum Ausdruck, dass das subjektiv-dingliche Recht der Bewirtschaftung eines bestimmten Grundstücks dient oder sinnvoll nur zusammen mit diesem Grundstück ausgenutzt werden kann. Außer der Grunddienstbarkeit des § 1018 gibt es noch andere subjektiv-dingliche Rechte: die Reallast, § 1105 II; das dingliche Vorkaufsrecht, § 1094 II; Überbau- und Notwegrenten sind stets subjektiv-dingliche Rechte, vgl §§ 913, 917.
Im Fall 8ist das Recht am Steinbruch des E als Grunddienstbarkeit bezeichnet, „herrschendes Grundstück“ ist das Fabrikgrundstück. Dessen jeweiliger Eigentümer ist also berechtigt, die Kalksteine zu gewinnen. Das Überfahrtsrecht am Grundstück des N ist dagegen keine Grunddienstbarkeit, weil es nicht im Grundbuch eingetragen ist. Das Recht beruht lediglich auf einer schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen U und N. Somit steht es in keinem Objektszusammenhang mit dem Fabrikgrundstück oder der Grunddienstbarkeit. Das Überfahrtsrecht müsste also, falls der U das Unternehmen veräußert, besonders abgetreten oder für den Erwerber neu begründet werden.
169
6. Eine losere Form der Verbindung von Rechtsobjekten bewirkt die Eigenschaft einer Sache als Zubehör, § 97. Der wirtschaftliche Nutzungszusammenhang von Hauptsache und Zubehör wird anerkannt, aber nur mit verhältnismäßig geringen Rechtsfolgen ausgestattet. Die Hauptsache kann ein Grundstück oder eine bewegliche Sache, aber kein Recht sein. Nur bewegliche Sachen, nicht Grundstücke oder Rechte, können Zubehör sein. Was alles „dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt“ ist, richtet sich nach der Verkehrsanschauung, § 97 I 2 (vgl BGH NJW 2009, 1078 für die Einbauküche eines Mieters). Beispiele für Zubehör nennt § 98.
Die Zubehörstücke bleiben sonderrechtsfähig, sie müssen also nicht unbedingt im Eigentum desjenigen stehen, dem die Hauptsache gehört (vgl § 926 I, II; §§ 1120 ff iVm §§ 90 II, 55 II ZVG). Folge der Zubehöreigenschaft ist, dass Verpflichtungen bezüglich der Hauptsache im Zweifel (also nur Auslegungshilfe!) auch für ihr Zubehör gelten, § 311c; dass Grundstückszubehör mit dem Grundstück übereignet wird, § 926; und dass für die Grundpfandrechte (Hypothek, Grund- und Rentenschulden) auch das Zubehör des Grundstücks haftet, §§ 1120 ff. Zur Zwangsvollstreckung in Zubehör s. unten Rn 175.
Durch die Zubehöreigenschaft ist im Fall 8ein Teil der Sachen, die nicht Bestandteile sind (Zubehöreigenschaft setzt selbstständige Sachen voraus, Bestandteile sind unselbstständige Sachteile), mit anderen verbunden: Die Maschinen, die nicht Bestandteile des Grundstücks sind, sind Zubehör; ebenso die Lastwagen. Auch wenn sie weite Fahrten machen, stehen sie doch immer noch in einem ihrer Nutzung entsprechenden räumlichen Verhältnis zum Fabrikgrundstück des U.
Читать дальше