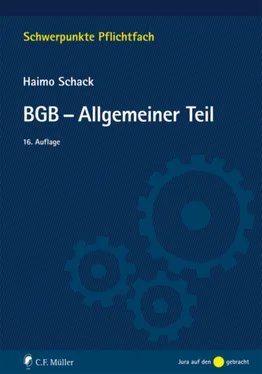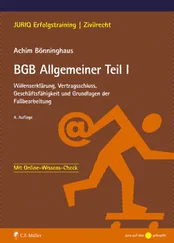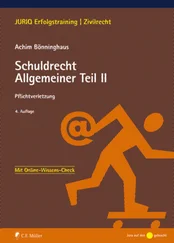129
Einen gewissen Spielraum hat der Gesetzgeber beim Beginn der Rechtsfähigkeitder natürlichen Person. So hat sich § 1 BGB aus Gründen der Praktikabilität für die Vollendung der Geburt entschieden. In einzelnen Fällen wird, um einem besonderen Schutzbedürfnis nachzukommen, die Rechtsfähigkeit vorverlegt, ein Erzeugter (nasciturus) schon vor Vollendung der Geburt so behandelt, als wäre er bereits geboren (zB §§ 844 II 2, 1923 II; oben Rn 8).
130
Mit dem Tod endetder Mensch und damit auch seine Rechtsfähigkeit, ohne dass das Gesetz das ausdrücklich anordnen müsste. Auch den Zeitpunkt des Todes als Ende der Rechtsfähigkeit lässt das Gesetz offen. Mit dem Tod fällt das Rechtssubjekt fort. An dessen Stelle tritt automatisch der Erbe. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolgegehen alle Rechte und Pflichten auf den Erben über, ohne dass es irgendeiner Übertragungshandlung oder auch nur der Kenntnis des Erben bedürfte (oben Rn 21). Eine der Vorverlegung der Rechtsfähigkeit zugunsten des Erzeugten entsprechende Verlängerung der Rechtsfähigkeitüber den Tod hinaus gibt es nicht, wohl aber können Willenserklärungen des Verstorbenen über seinen Tod hinaus derart wirken, dass die Rechtsfolgen beim Erben eintreten (oben Rn 41).
131
Da das Menschsein nur mit dem Tod endet, ist der Tod der einzige Beendigungsgrund der Rechtsfähigkeit; insbesondere kann sie nicht durch Staatsakt entzogen werden. Die Todeserklärungnach dem VerschollenheitsG begründet nur eine widerlegliche Vermutung für den Tod und seinen Zeitpunkt (bis dahin Lebensvermutung), beendet als solche aber die Rechtsfähigkeit nicht (oben Rn 26).
132
3. Die juristische Personist eine Zusammenfassung von Personen (natürlichen oder juristischen) oder Vermögensgegenständen zu einer Organisation, der die Rechtsordnung eigene Rechtspersönlichkeit verliehen hat. Die eigene Rechtsfähigkeit ist Begriffsmerkmal der juristischen Person und unterscheidet sie von anderen Zusammenschlüssen. Im Gegensatz zur natürlichen Person beruht die Rechtsfähigkeit der juristischen Person auf einem konstitutiven(rechtsbegründenden) Staatsakt. Abgesehen von einigen althergebrachten juristischen Personen des öffentlichenRechts, wie dem Staat, Kirchen und Gemeinden (oben Rn 75), entsteht die juristische Person des öffentlichen Rechts durch einen Staatsakt, der grundsätzlich allein den Zusammenschluss und dessen Rechtsfähigkeit bewirkt, während bei der juristischen Person des privatenRechts die Rechtsfähigkeit auf dem Zusammenspiel von konstitutivem Staatsakt und privatrechtlichem Gründungsakt beruht (oben Rn 99).
133
Ob der Staat einem Zusammenschluss Rechtsfähigkeit verleiht, steht grundsätzlich in seinem Ermessen. Um dem Bürger aber die Freiheit zu einem rechtsfähigen Zusammenschluss zu gewähren, sind die Voraussetzungen, unter denen der konstitutive Staatsakt erfolgen muss, generell und abstrakt bestimmt. Die Voraussetzungen sind so gefasst, dass die juristische Person jeweils die ihrem Zweck entsprechenden Einrichtungen auch und gerade im Interesse Dritter (des Rechtsverkehrs) besitzen muss. Das Normativsystemist damit eine Synthese von Vereinigungsfreiheit und Ordnungsfunktion des Rechts (oben Rn 90).
Die juristische Person des Privatrechts entsteht mit Eintragung im Vereins-, Handels- bzw Genossenschaftsregister. Diese Eintragungen sind Hoheitsakte der freiwilligen Gerichtsbarkeit.[1] Der unterschiedliche Eintragungsort weist darauf hin, dass der eV des § 21 als nichtwirtschaftlicher Verein (= Idealverein, oben Rn 92 ff) bürgerlich-rechtlich konzipiert ist, während die handelsrechtlichen Typen auf die Besonderheiten des Geschäftslebens abgestellt sind. Das Normativsystem trägt diesen funktionellen Unterschieden Rechnung.
134
Der wirtschaftliche Verein des § 22 erhält Rechtsfähigkeit durch Verwaltungsakt, auf den kein Rechtsanspruch, wohl aber ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, besteht. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) als Unterfall des wirtschaftlichen Vereins wird mit Genehmigung, die gleichzeitig die Erlaubnis zum Versicherungsbetrieb darstellt, rechtsfähig, § 15 VAG.
135
So wie der Staat die Rechtsfähigkeit schafft, kann er sie auch beenden. Die Rechtsfähigkeit juristischer Personen endet durch Auflösung des Vereins, Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder durch Entziehung der Rechtsfähigkeit, s. §§ 41 ff BGB (zu § 43 aF [heute § 395 FamFG] vgl BVerwGE 105, 313 = NJW 1998, 1166 mit Anm. K. Schmidt 1124 – Scientology; BGHZ 175, 12, 19 f – Kolpingwerk).
F136
4. Als Kennzeichen der hier nicht näher zu behandelnden juristischen Personen des öffentlichen Rechtswird man, wenn nicht die Gründung, so doch die Anerkennung als Träger öffentlicher Aufgaben durch Hoheitsakt ansehen müssen. Man unterscheidet Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, vgl § 89. Anders als bei privaten Vereinen (für sie gilt die negative Koalitionsfreiheit des Art. 9 GG), gibt es bei Körperschaften (= Personenzusammenschlüssen) des öffentlichen Rechts auch automatische oder erzwungene Mitgliedschaft (BVerfGE 38, 281, 297 mwN, zB in der Handwerkskammer). Neben Personenvereinigungen gibt es Zusammenfassungen von zweckgebundenen Vermögensgegenständen; das sind im Privatrecht die Stiftungen und im öffentlichen Recht neben den Stiftungen auch die Anstalten.
Die juristische Person des öffentlichen Rechts lebt grundsätzlich nach öffentlichem Recht. Ihre Rechtsfähigkeit ermöglicht es ihr, auch privatrechtliche Rechte und Pflichten zu haben. Sie unterliegt, soweit sie fiskalisch (Gegensatz: hoheitlich) handelt, dem privaten Haftungsrecht der §§ 89, 31, 831. Sie haftet für hoheitliches Handeln ihrer „Beamten“ über § 839 gemäß Art. 34 GG. Die Einzelheiten gehören ins Staatshaftungsrecht.
137
5. Den juristischen Personen stehen die Gesellschaften des BGB, §§ 705 ff, sowie die OHG und KG (§§ 105 ff, §§ 161 ff HGB) als Personenzusammenschlüssegegenüber. Bei ihnen sind nach der Konzeption des Gesetzes die Gesellschafter Träger aller auf die Gesellschaft bezogenen Rechte und Pflichten. Das Gesellschaftsvermögen ist den Gesellschaftern in ihrer Gesamtheit zugeordnet. Sie sind gesamthänderisch Träger des Vermögens, dh jeder Gesellschafter ist Träger der zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Rechte, zugleich in seiner Herrschaftmacht jedoch durch die der übrigen Gesellschafter beschränkt.
138
Bei den genannten „rechtsfähigen Personengesellschaften“ iSv § 14 II wird dagegen heute die Gesellschaft selbst als Vermögensträger angesehen. Die Rechtsordnung kann also die Einheit der Gesellschaft unterschiedlich stark betonen und so die Gesellschaft praktisch mehr oder weniger der juristischen Person annähern, wie das sehr weitgehend, vor allem für die OHG und KG durch § 124 HGB und für die BGB-Gesellschaft durch BGHZ 146, 341 geschehen ist (s. oben Rn 82a).
Die Praxis hat den nichtrechtsfähigen Verein entgegen der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers faktisch dem rechtsfähigen gleichgestellt (oben Rn 108, 121 f). Das wirkt sich vor allem in der Haftung aus.
139
Im Einzelnen gilt für die Haftungfolgendes: Die Rechtsfähigkeit der juristischen Person bedeutet, dass sie selbst Subjekt der Pflicht ist, ungeachtet möglicher besonderer Haftungsanordnungen zu Lasten der Mitglieder. Das Gleiche gilt für die „rechtsfähigen Personengesellschaften“, bei denen ggf (analog § 128 HGB) eine akzessorische Haftung auch der Gesellschafter besteht, wie zB bei der Außen-GbR. Dagegen haften bei nichtrechtsfähigen Zusammenschlüssen, wie etwa einer Innen-GbR, die Mitglieder für die „Verbindlichkeiten des Zusammenschlusses“ persönlich und gesamtschuldnerisch (§§ 709, 714, 427).
Читать дальше