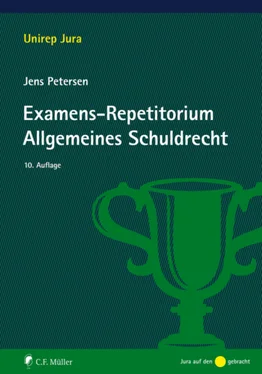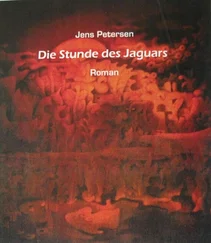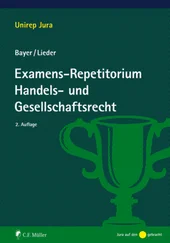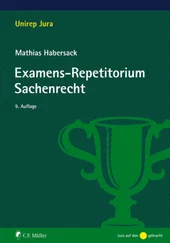1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Den Schadensersatz wegen solcher Nebenpflichtverletzungen zeigt unser Fall 4: Bei der Ausführung von Elektroarbeiten beschädigt der Elektriker E aus Unachtsamkeit Einrichtungsgegenstände im Hause des B. Als B den E nach der Beschädigung zur Rede stellt, wird er von diesem auf das Übelste beleidigt. Daraufhin wird es dem B zu viel. Er verweist den E des Hauses und lässt die noch unerledigten Arbeiten durch X erledigen, der dafür 300 € mehr verlangt. Welche Ansprüche hat B gegen E?
34
1. Wegen der Mehrkostenfür den anderen Elektriker könnte B gegen E einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung aus §§ 280 I 1, III, 282 haben. Voraussetzung dafür ist zunächst die Verletzung einer nicht leistungsbezogenen Nebenpflicht aus dem Schuldverhältnis.
34a
a) Eine derartige Nebenpflichtverletzung im Sinne des § 241 II liegt in mehrfacher Hinsicht vor. Zunächst besteht sie darin, dass E Einrichtungsgegenstände des B, also dessen sonstige Rechte, beschädigt hat. Zudem liegt in der massiven Beleidigung eine Beeinträchtigung des Rechtsguts der Ehre. Diese Pflichtverletzungen muss E zu vertreten haben. Hinsichtlich der Beleidigungen handelte E vorsätzlich, vgl. § 276 I 1. Die Beschädigung der Einrichtungsgegenstände geschah dagegen aus Unachtsamkeit. Mangels Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 II) liegt somit Fahrlässigkeit vor. Damit sind die Voraussetzungen des § 280 I 1 gegeben, auf die § 282 Bezug nimmt.
35
b) Schadensersatz statt der Leistungkann freilich nach § 280 IIInur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 282 verlangt werden. Neben der Verletzung einer nicht leistungsbezogenen Nebenpflicht gemäß § 241 II ist danach erforderlich, dass dem Gläubiger die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist (Unzumutbarkeit). Für die Beantwortung dieser Wertungsfrage sind die Interessen des Gläubigers und des Schuldners unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und der Grundsätze von Treu und Glauben abzuwägen[108]. Die Unzumutbarkeit muss dabei auf der Verletzung der Nebenpflicht beruhen. Die Beschädigung der Einrichtungsgegenstände als bloße Verletzung eines sonstigen Rechtsguts genügt in der Regel noch nicht für die Annahme der Unzumutbarkeit, weil der Gläubiger den dadurch entstehenden Schaden gemäß § 280 I 1 vom Schuldner ersetzt verlangen kann[109]. Vielmehr muss die Pflichtverletzung den Verdacht begründen, sich auch künftig zu wiederholen, so dass das Vertrauen auf die korrekte Pflichterfüllung zerstört ist. Ob für die Annahme der Unzumutbarkeit eine vom Schuldner missachtete Abmahnung erforderlich ist[110], kann hier dahinstehen, weil jedenfalls eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung bereits beim ersten Vorkommen das Vertrauensverhältnis zerstört, mithin Unzumutbarkeit begründet[111]. E hat B auf das Übelste beleidigt. Aufgrund dieser schwerwiegenden Ehrverletzung ist dem B ein Festhalten an der Vertragserfüllung unzumutbar. B kann daher Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Dieser umfasst auch und gerade die Mehrkosten eines Deckungsgeschäfts[112], hier also die der anderweitigen Auftragsvergabe an X mitsamt der entstehenden Mehrkosten in Höhe von 300 €.
36
Ein Anspruch aus § 823 I kommt wegen der Mehrkosten nicht in Betracht, weil es sich insoweit nur um einen primären Vermögensschaden handelt[113]. Hier zeigt sich im Übrigen eine Besonderheit des § 241 II, denn die Erwähnung der „Rechtsgüter und Interessen“ soll gerade zum Ausdruck bringen, dass die Schutzpflichten auch zum Schutz des Vermögens bestehen können und nicht nur die absoluten Rechte i. S. d. § 823 I schützen.
37
2. Bezüglich der zerstörten Einrichtungsgegenstände hat B gegen E einen Anspruch auf Schadensersatz nach §§ 280 I 1, 241 II, da E seine Nebenpflicht aus dem Werkvertrag fahrlässig verletzt hat. Des Weiteren hat B gegen E einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 I wegen der fahrlässig zerstörten Einrichtungsgegenstände, da E das Eigentum des B rechtswidrig und schuldhaft verletzt hat.
38
3. Wegen der Ehrverletzung steht dem B dagegen kein Schadensersatzanspruch zu. Die Ansprüche aus § 280 I 1 sowie aus § 823 I und § 823 II i. V. m. § 185 StGB[114] scheitern zumindest am ersatzfähigen Schaden. Ein Vermögensschaden ist nicht entstanden und die Vorschrift des § 253 II beschränkt die Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden (abweichend vom Katalog des § 823 I!) auf die Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit und der sexuellen Selbstbestimmung; die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wird damit ausdrücklich nicht erfasst[115]. Zwar ist anerkannt, dass bei besonders schweren Beeinträchtigungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch immaterielle Schäden direkt nach § 823 I ersetzt werden können[116], allerdings dürfte es hier an einer solchen besonders schweren Beeinträchtigung der Ehre des B fehlen.
2. Pflichtverletzung beim nichtigen Vertrag
39
Entscheidend ist hier, wie auch sonst in der Fallbearbeitung, weniger die genaue Kategorisierung, als vielmehr der Blick auf die Rechtsfolgen. § 280 I 1 erfasst nicht nur Haupt- und Nebenleistungspflichten, sondern auch die Verletzung von nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten (Schutzpflichten).
Dass dies insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung von Leistungs- und Schutzpflichtengilt, soll unser Fall 5zeigen: U hat im Hause des B unter Verstoß gegen das SchwarzArbG Reparaturarbeiten zu dessen Zufriedenheit verrichtet, jedoch den Wasserhahn vergessen zuzudrehen. Kann B von U Ersatz wegen der Wasserschäden verlangen?
40
1. In Betracht kommt zunächst ein Anspruch aus §§ 634 Nr. 4, 280 I 1. Voraussetzung dafür ist die Verletzung einer Pflicht aus einem Schuldverhältnis.
Fraglich ist, ob ein Schuldverhältnis besteht. Ein solches könnte in dem zwischen B und U geschlossenen Werkvertrag (§ 631) liegen. Das entspricht § 311 I, wonach zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft grundsätzlich ein Vertrag erforderlich ist. Eine dahingehende Einigung liegt vor. Es fragt sich jedoch, ob die mögliche Unwirksamkeit des zwischen B und U geschlossenen Vertrags daran etwas ändert. Dieser könnte nämlich nach § 134 i. V. m. § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG nichtig sein. Letzteres ist im Hinblick auf seine Schutzzwecke (Schutz des Handwerks, Vermeidung von Steuerausfällen) ein Verbotsgesetz i. S. d. § 134[117]. Soweit B von dem Gesetzesverstoß wusste und ihn – angesichts der hinterzogenen Umsatzsteuer etwa durch einen Preisabschlag – bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzte[118], ist der Werkvertrag zwischen B und U nichtig, so dass ein Anspruch aus §§ 634 Nr. 4, 280 I mangels wirksamen Werkvertrags ausscheidet. Damit stellt sich die Frage, ob jedoch eine Haftung aus § 280 I 1 auch bei nichtigen Verträgen möglich ist. Das erscheint auf den ersten Blick paradox, ist aber, soweit Schutzpflichten betroffen sind, grundsätzlich möglich. Die Nichtigkeit des zugrunde liegenden Vertrags bewirkt, dass die Leistungspflichtenzwischen den Beteiligten ausgesetzt sind. Dagegen bestehen die Schutzpflichtenungeachtet der Nichtigkeit des Vertrags[119]. Denn diese beginnen mit dem ersten rechtsgeschäftlichen Kontakt zwischen den Beteiligten (§ 311 II) und verdichten sich dann gleichsam, so dass sie auch während der Durchführung des vermeintlich wirksamen Vertrags mit dem Inhalt bestehen, dass die Rechtsgüter des anderen Teils nicht gefährdet oder verletzt werden dürfen. Die Nichtigkeit des Werkvertrags steht der Annahme eines Schuldverhältnisses nach §§ 311 II, 241 II also nicht entgegen.
Читать дальше