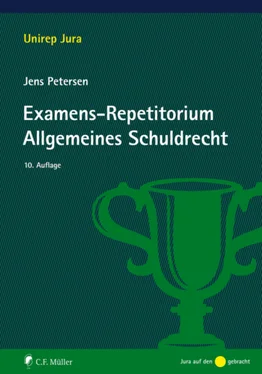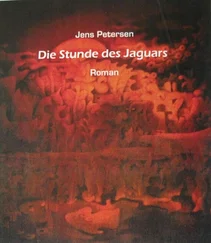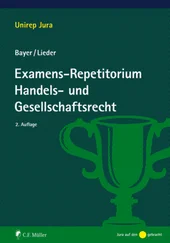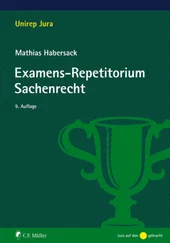18
K könnte gegen V einen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks aus §§ 433 I, 464 II, 1098 I 1 haben. Ein entsprechender Kaufvertrag, der die Pflicht zur Übereignung begründet, ist zwischen K und V durch die Ausübung des Vorkaufsrechts gegenüber dem V zustande gekommen, und zwar mit dem Inhalt, wie er zwischen V und D vereinbart war, §§ 464 II, 1098 I 1[38]. Das Vorkaufsrechtist mit der Eintragung ins Grundbuch entstanden, § 873 I. Die Form des § 311b I ist nur im Rahmen des zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts einzuhalten[39], also im Rahmen der Verpflichtung des V, dem K ein dingliches Vorkaufsrecht zu bestellen, sowie im Rahmen des Kaufvertrags zwischen V und D. Dass der Vertrag zwischen K und V nur privatschriftlich geschlossen wurde, schadet im Hinblick auf die sachenrechtliche Begründung des Vorkaufsrechts nach dem Trennungsprinzipnicht. Gleichzeitig ist der Vertrag über die Begründung des dinglichen Vorkaufsrechts mit der Eintragung des Vorkaufsrechts im Grundbuch entsprechend § 311b I 2 wirksam geworden[40]. Eine direkte Anwendung scheitert, weil sich der Wortlaut des § 311b I 2 („ Auflassungund Eintragung“) nur auf den Verkauf eines Grundstücks, nicht aber auf die Einräumung eines Vorkaufsrechts bezieht. Der Anspruch des K auf Übereignung ist folglich entstanden. Er könnte jedoch durch Übereignung des Grundstücks an D durch Unmöglichkeitnach § 275 Ierloschen sein. Darauf spielt V an, wenn er meint, dass er außerstande sei zur Übereignung an K. Nach § 275 I ist der Anspruch auf die Leistung ausgeschlossen, soweit und solange diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Dabei kann hier dahinstehen, ob die Leistung für jedermann unmöglich ist, etwa weil und sofern D übereignen könnte. Denn als Inhaber eines dinglichen Vorkaufsrechts kommt dem K über die Verweisung in § 1098 II die Vormerkungswirkung des § 883 II zugute. Das bedeutet, dass die Verfügung des V an D dem K gegenüber (relativ) unwirksam ist. Mithin ist die Leistung – Übereignung des Grundstücks an K trotz Weiterveräußerung – dem Schuldner V nicht unmöglich, so dass der Anspruch auf Übereignung aus Kaufvertrag gemäß §§ 433 I, 464 II, 1098 I 1 gegen V besteht. Gegen D hat K den unselbstständigen Hilfsanspruch aus § 888 I[41] i. V. m. § 1098 II auf Zustimmung zur Grundbuchberichtigung, dessen Existenz im Übrigen das obige Ergebnis – keine Unmöglichkeit infolge der Weiterveräußerung – bestätigt[42].
19
Beachte:
Die Bestellung eines dinglichen Vorkaufsrechts führt zu einem Schuldverhältnis zwischen den Beteiligten. Verletzt der Verpflichtete beispielsweise die aus § 469 I resultierende unverzügliche Mitteilungspflichtschuldhaft, dann schuldet er dem Berechtigten Schadensersatz aus § 280 I. Allgemein führt die Bestellung eines beschränkt dinglichen Rechts zu einem Begleitschuldverhältnis, das zwischen dem Eigentümer der Sache oder Besteller des dinglichen Rechts einerseits und dem Erwerber des Rechts andererseits begründet wird[43]. Dieses Begleitschuldverhältnis wird teils als gesetzliches[44], teils als vertragliches qualifiziert[45]; in jedem Fall kann die Verletzung einer Pflicht aus diesem Schuldverhältnis einen Anspruch aus § 280 I begründen[46].
II. Einteilung der Schuldverhältnisse
1. Schuldverhältnis im engeren und weiteren Sinne
20
Wenn bisher vom Schuldverhältnis gleichbedeutend mit der Forderung gesprochen wurde, so bedarf dies der Präzisierung. Es handelt sich dabei nur um das Schuldverhältnis im engeren Sinne. Darüber hinaus spricht man vom Schuldverhältnis im weiteren Sinne, wenn vom Gesamtgefügeder Rechte und Pflichten aus einer rechtlichen Verbindung die Rede ist. So ergibt sich aus den beiden Absätzen des § 433 ein ganzes Bündel von Forderungen und Pflichten, das als Schuldverhältnis im weiteren Sinne angesehen werden kann[47]. Dieses wird mitunter als „Organismus“ oder bewegliches Gefüge[48] bezeichnet, weil sich auch das Schuldverhältnis mit der Zeit verändern kann. In der Fallbearbeitung sollte man sich indes mit derart blumigen Begriffen tunlichst zurückhalten.
2. Einseitig verpflichtende und gegenseitige Verträge
21
Von den gegenseitigen (synallagmatischen) Verträgen, wie Kauf, Miete, Werkvertrag, bei denen für die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Hauptpflichten die §§ 320 ff.gelten[49], unterscheidet man die einseitig verpflichtenden Schuldverträge. Dazu gehören etwa die Schenkung sowie grundsätzlich die Bürgschaftoder das Darlehen, weil dieses nicht etwa gegeben wird, damit der Darlehensgeber die Darlehenssumme zurückerhält (häufiger Fehler). Handelt es sich jedoch, wie zumeist der Fall, um ein verzinsliches Darlehen, liegt ein gegenseitiger Vertrag vor, weil die Pflicht zur Zinszahlung die Gegenleistung darstellt[50]. Ebenso verhält es sich bei der entgeltlichen Bürgschaft[51]. Davon zu unterscheiden sind die unvollkommen zweiseitig verpflichtenden Verträge, wie etwa der Auftrag[52] oder die Leihe[53]. Diese wiederum sind nicht zu verwechseln – was freilich aufgrund der uneinheitlichen Terminologie nicht leicht fällt[54] – mit den unvollkommenen Verbindlichkeiten(§§ 656, 762[55]), deren Besonderheit darin besteht, dass bei ihnen nicht auf Erfüllung geklagt werden kann (Naturalobligationen), das dennoch Geleistete jedoch nicht kondiziert werden kann, weil diese Verträge zwar keine Verbindlichkeit begründen, sie aber nach Erfüllung gleichwohl einen Behaltensgrund darstellen[56]. Mitunter werden unwirksame Schuldverträge schließlich erst durch Heilungwirksam. So liegt es etwa in den Fällen der §§ 311b I 2, 518 II, 494 II und § 766 S. 3. Auch hier kann nicht auf Erfüllung geklagt werden. Ist jedoch geleistet worden, stellt der dadurch wirksam gewordene Schuldvertrag einen Rechtsgrund zum Behaltendürfen dar[57].
III. Verpflichtung und Verfügung
22
Es besteht auch unter Examenskandidaten ein weitverbreitetes Missverständnis dahingehend, dass der Schnitt zwischen Verpflichtung und Verfügung scharf zwischen dem zweiten und dritten Buch des BGB gezogen sei. Auch im Schuldrecht sind jedoch Verfügungen geregelt[58]. Speziell im Allgemeinen Teil sind die Abtretung[59] und der Erlass[60] zu nennen. Deshalb ist auch die Forderung tauglicher Gegenstand von Verfügungen. Während die Übertragung der Forderung im Allgemeinen Schuldrecht geregelt ist, finden sich für die Belastung der Forderung die einschlägigen Vorschriften im Sachenrecht (etwa §§ 1273 ff.)[61].
23
Verfügungen sind abstrakt, weil der Rechtsgrund und die Erreichung eines Leistungszwecks[62] nicht zu ihrem Tatbestand gehört[63]. Wird der Leistungszweckverfehlt, so kann dies im Wege der Leistungskondiktion des Veräußerers ausgeglichen werden. Schuldverträge können danach unterschieden werden, ob sie abstrakt vom Geschäftszweck sind (abstrakte Verträge)oder ob dieser zum Geschäftszweck gehört (kausale Verträge)[64]. Letztere sind der Regelfall und liegen immer dann vor, wenn es sich um einen beidseitig verpflichtenden Vertrag handelt, für den der Austauschzweck charakteristisch ist. Erstere dagegen „geben keine Antwort auf die Frage nach dem Warum der Verpflichtung“[65]. Beispiele hierfür sind die §§ 780, 781[66] und § 793. Dagegen gibt es keine kausalen Verfügungen[67]. Wenn beim abstrakten Vertrag der Bezug auf die zweckorientierte Verbindlichkeit (etwa eine Schenkung beim fingierten Rechtsgrund ohne Gegenleistung[68]) verfehlt wird, entsteht die abstrakte Verbindlichkeit dessen ungeachtet, kann aber durch Vertrag aufgehoben und kondiziert werden[69]. Das Risiko bei der rechtsgrundlosen Verfügung besteht darin, dass der Erwerber den zugewandten Gegenstand als Berechtigter weiterveräußert, einer seiner Gläubiger in ihn vollstreckt oder der Erwerber nach § 818 III entreichert ist[70].
Читать дальше