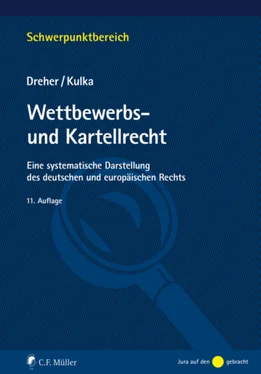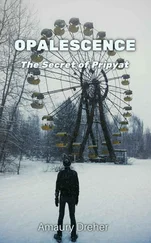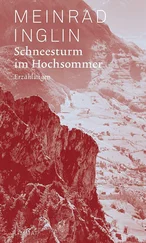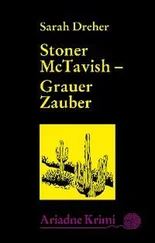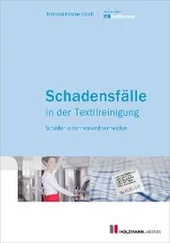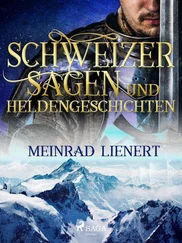1 ...8 9 10 12 13 14 ...45 36
Große Teile des EU-Kartellrechts finden sich allerdings nicht im AEUV, sondern im sekundären EU-Recht, das auf der Grundlage von Art. 103 AEUV erlassen worden ist. Das gilt insbesondere für die VO Nr. 1/2003,[2] die das Kartellverfahrensrechtenthält, und für die Gruppenfreistellungsverordnungengem. Art. 101 Abs. 3 AEUV, die bestimmte Gruppen von Vereinbarungen vom Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV freistellen. Überdies ordnet das EU-Kartellrecht auf Grund von Verordnungen gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV, unterstützt durch die Richtlinien-Gesetzgebung, einige Zweige des Besonderen Wirtschaftsrechts und verdrängt oder verändert dadurch die nationalen Branchenregelungen. Dies kommt dem Binnenmarkt zugute und beseitigt wettbewerbshemmende Regelungen. Schließlich verfügt das EU-Kartellrecht seit 1989 über eine Verordnung über die Zusammenschlusskontrolle.[3] Sie unterwirft bedeutende Konzentrationsvorgänge innerhalb des Binnenmarktes einer Kontrolle durch die Kommission und verdrängt insoweit das nationale Recht.
37
b) Die Kartellrechte der Mitgliedstaatenhaben neben dem EU-Kartellrecht ihren Platz, wo Wettbewerbsbeschränkungen den zwischenstaatlichen Handel nicht spürbar beeinträchtigen. Hinzu kommt der Bereich, in dem sich die nationalen Kartellrechte vom europäischen Kartellrecht nach Art. 3 VO 1/2003 unterscheiden dürfen. Daher gibt es noch immer erhebliche Unterschiede im Normbestand und in der Anwendungspraxis, obwohl sich die nationalen Kartellrechte dem europäischen Kartellrecht immer mehr angenähert haben.[4]
38
Bei spürbarer Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels wird das EU-Recht von der Anwendungskonkurrenzzwischen Kommission und nationalen Stellen beherrscht (vgl. Art. 4 ff VO Nr. 1/2003). Allerdings kann die Kommission Verfahren zur Durchsetzung von Art. 101 f AEUV jederzeit an sich ziehen (Art. 11 Abs. 6 VO Nr. 1/2003). In der Zusammenschlusskontrolle werden zudem – abgesehen von wenigen Ausnahmen – die großen Fälle von der Kommission nach EU-Recht und nur noch die übrigen von den nationalen Kartellbehörden nach nationalem Recht beurteilt (Art. 4, 9, 21 FKVO).
[1]
Vgl. ausf. Rdnr. 736.
[2]
VO (EG) Nr. 1/2003 v. 16.12.2002, ABl.EG Nr. L 1 v. 4.1.2003, S. 1 mit späteren Änderungen.
[3]
Vgl. dazu unten § 14 ( Rdnr. 1480 ff).
[4]
Vgl. dazu bereits Dreher , AG 1993, 302 ff; ders ., in: FS Söllner, 2000, S. 217 ff.
3. Die EU und das Unlauterkeitsrecht
39
Der AEUV spricht zwar in Satz 4 seiner Präambel von einem „redlichen Wettbewerb“, der zu gewährleisten sei, gibt aber der Union dafür keine ausdrückliche Regelungskompetenz. Allerdings ermöglichen die Binnenmarkt- und Verbraucherschutzkompetenzen(Art. 4 Abs. 2 lit. a und f AEUV) der EU, (nur) mit diesem rechtspolitischen Ziel Vorschriften über die Werbung, das Inverkehrbringen gewisser Waren und dergleichen zu erlassen. Da nach dem Subsidiaritätsprinzip in diesen Bereichen jedoch primär die Mitgliedstaaten verantwortlich sind, stößt die Union an Grenzen. Die nationalen Unlauterkeitsrechte sind als spezielles Deliktsrecht bzw. als Randgebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes vielfältig mit der jeweiligen Gesamtrechtsordnung verknüpft und verwirklichen sich weithin im Richterrecht. Sie sperren sich daher gegen die Harmonisierung stärker als die Kartellrechte. Zudem fehlt für das Unlauterkeitsrecht ein unionsrechtliches Paradigma, wie es für das Kartellrecht auch die tägliche Praxis in den Art. 101 ff AEUV vor Augen hat.
40
Obwohl danach eine ausdrückliche Kompetenzvorschrift für das Unlauterkeitsrecht fehlt, hat die EU zahlreiche einschlägige Richtlinienzur Rechtsangleichung erlassen.[1] Bedeutsam sind neben einigen speziellen Regelungen[2] die Datenschutzrichtlinie 2002/58/EG für elektronische Kommunikation, die Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung und vor allem die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-RL, geändert durch RL (EU) 2019/2161). Die Richtlinien divergieren in ihrem Anwendungsbereich und betreffen teils den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen („B2B“), teils denjenigen zwischen Unternehmen und Verbrauchern („B2C“). Das ist misslich, weil es eine prinzipiell nicht wünschenswerte Aufspaltung der wettbewerbsrechtlichen Maßstäbe begünstigt.
41
Die Umsetzung der UGP-RL in mehreren Anläufen[3] hat die Probleme und Grenzen möglicher Rechtsangleichungin dem von den Bedürfnissen des Alltags nach Vorhersehbarkeit, Handhabbarkeit, Zügigkeit und Ortsnähe geprägten Wettbewerbsrecht aufgezeigt. Auch der Prozess der Konkretisierung der Richtlinien durch den EuGH verläuft schleppend und mühsam. Kaum mehr Rechtssicherheit ergibt sich, wenn die Union an Stelle von Richtlinien direkt anwendbare Verordnungenerlässt, um Sachverhalte selbst mit unmittelbarer Wirkung zu regeln. Beispiele sind die sog. P2B-Verordnung[4] und künftig vielleicht eine „ePrivacy“-Verordnung.[5] Außerdem ist ein Zuwachs an Bürokratiefestzustellen, der mit der EG-VO 2006/2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz und ihrer Nachfolgerin, der EU-VO 2017/2394, verbunden ist. Letztere wird in Deutschland auf der Grundlage des im Jahr 2020 geänderten und umbenannten EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes (EU-VSchDG) vom BMJV als „Zentrale Verbindungsstelle“ und in Einzelfällen vom Bundesamt für Justiz und weiteren Behörden ausgeführt.
42
Neben den Richtlinien und Verordnungen war es vor allem die Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten, die die Unlauterkeitsrechte der Mitgliedstaaten einander näherbrachte. Sie hat auch das deutsche Recht erheblich beeinflusst. Dabei vollzog sich dessen Anpassung an das EU-Recht nicht ohne Schwierigkeiten, weil der deutsche Gesetzgeber das abweichende EU-Recht lange Zeit fast ignorierte und seine traditionelle Rechtspolitik fortsetzte.[6] Erst 1994 setzte die Bundesregierung unter dem Eindruck der Rechtsprechung des EuGH zu einer anderen, liberaleren UWG-Politik an, konnte diese aber nur schrittweise verwirklichen.[7] Gleichzeitig und bis zuletzt behielt der deutsche Gesetzgeber seine berechtigte Zurückhaltung gegenüber dem oft kompromisshaften, terminologisch fragwürdigen und unsystematischen Unionsrecht bei.
43
Der Weg zu einem einheitlichen Unlauterkeitsrechtinnerhalb der EU ist insgesamt auf Grund der erheblichen Anstrengungen in den letzten Jahren vielleicht etwas kürzer geworden. Die verbleibenden unterschiedlichen Vorstellungen von der Unlauterkeit[8] werden sich mit der Zeit vermutlich weiter annähern, je mehr es zu einem wirklichen Binnenmarkt kommt.
[1]
Vgl. dazu Rdnr. 75 ff.
[2]
Vgl. etwa RL (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse); RL (EU) 2019/633 über unlautere Handelspraktiken in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette.
[3]
Vgl. dazu Rdnr. 55 ff.
[4]
VO (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten.
[5]
Vorschlag für eine Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation v. 10.1.2017, COM(2017) 10 final.
[6]
Vgl. etwa das Gesetz zur Änderung wirtschafts-, verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften v. 25.7.1986, BGBl. I 1986, S. 1169.
[7]
Vgl. insbes. die Gesetze zur Aufhebung der Zugabeverordnung v. 23.7.2001, BGBl. I 2001, S. 1661 (RegE: BTDrucks. 14/5594) und zur Aufhebung des Rabattgesetzes v. 23.7.2001, BGBl. I 2001, S. 1663 (RegE: BTDrucks. 14/5441), die 1994 im ersten Anlauf noch scheiterten.
Читать дальше